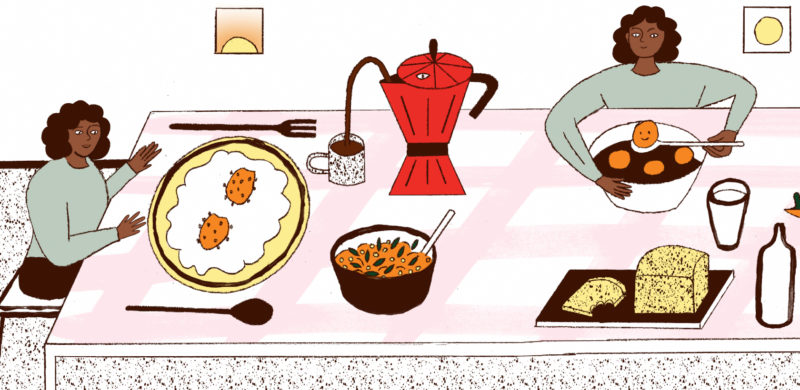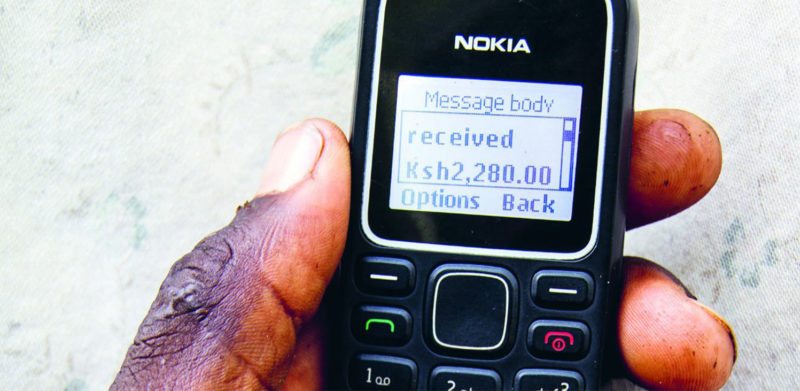Von der Reichenbachbrücke hat man einen guten Blick über das bunte Treiben an der Isar, dem Gebirgsfluss, der sich einmal quer durch München schlängelt. Jugendliche lassen sich durch das kühle Wasser treiben, ältere Menschen sitzen auf Findlingen, um sich abzukühlen, einige stehen knietief im Wasser und lesen ein Buch. Bis vor wenigen Jahren war all das nicht möglich. Auf acht Kilometern wurde die zuvor kanalisierte Isar renaturiert, seither wird sie intensiv genutzt, besonders bei warmen Temperaturen.
Die gibt es immer öfter, denn natürlich ist die Klimakrise auch in der bayerischen Landeshauptstadt schon heute deutlich spürbar: Die Tage werden heißer, die Hitzeperioden häufiger und intensiver. Auch nachts wird es wärmer: Die Wetterstationen registrieren immer mehr sogenannte tropische Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Im Vergleich zum ländlichen Umland ist die Hitzestressgefährdung in Städten deutlich größer, denn sie bilden Wärmeinseln – ein seit langer Zeit bekanntes Phänomen. Zu viel Asphalt, Beton, kaum Durchzug und wenige Grünflächen: Durch die dichte Bebauung
und den hohen Versiegelungsgrad führt dieser Wärmeinsel-
Effekt in München zu Temperaturen, die durchschnittlich 2 bis 3 Grad über denen des Umlands liegen. Nachts kann die Differenz sogar bis zu 10 Grad betragen.
Vor sechs Jahren hat die Stadt begonnen, sich strategisch mit den Herausforderungen der Klimakrise auseinanderzusetzen. „Ausschlaggebend waren die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es trotz Bemühungen zum Klimaschutz unvermeidbare Auswirkungen geben wird“, sagt eine Sprecherin des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU), das in diesem Aufgabenbereich federführend ist. Gemeinsam mit Experten vom Deutschen Wetterdienst hat die Stadt sehr präzise ausgewertet, welche spezifischen Risiken München durch die Klimakrise drohen.
Andauernde Trockenperioden, wie während der Dürre 2018 und sinkende Niederschlagsmengen bedingen eine Veränderung des Grundwasserstands und haben Auswirkungen auf die Vegetation in der Stadt. Umgekehrt sorgen die öfter auftretenden Starkregenereignisse für ein „Zuviel an Wasser“: Die zunehmende Versiegelung erschwert den Abfluss, es werden bessere Oberflächenentwässerung und mehr Überschwemmungsgebiete benötigt. Anpassungsbedarf besteht auch in Bezug auf Dachentwässerung und Windfestigkeit. Nachgedacht wird in München über veränderte Einsatzmuster bei der Feuerwehr oder vermehrte Trinkwasser-Chlorung zur Abtötung gesundheitsgefährdender Keime nach Starkregen.
Viel Niederschlag und Hochwasser sind Themen, die auch Unternehmen betreffen – etwa wegen Lieferverzögerungen oder leer zu pumpender Lager- und Verkaufsräume. Steigende Temperaturen und die Zunahme der Hitzeextrema erfordern zudem eine Anpassung der Regeln für die Gebäudetechnik, zum Beispiel zum sommerlichen Wärmeschutz. Besonders alte Menschen, Kranke und kleine Kinder werden mit Hitze schlecht fertig. Für Menschen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden und Lungenleiden können Tropennächte sogar lebensbedrohlich werden.
Auch für die Grün- und Freiflächen in der Landeshauptstadt bleibt die Klimakrise nicht ohne Folgen. Bei steigender Lufttemperatur und längeren Trockenperioden werden sie stärker genutzt und dringender gebraucht als ohnehin schon – weil sie bei Hitze angenehme Bedingungen versprechen und weil sie andere Teile der Stadt mit Kaltluft versorgen. Allerdings werden längere Trockenphasen und eine veränderte klimatische Umgebung auch der Flora zu schaffen machen: Pflanzen und Bäume sind nicht nur stärkerem Hitze- und Trockenheitsstress ausgesetzt, sie sind auch anfälliger für Schädlinge. Bäume in Parks, an Straßenrändern und auf Friedhöfen müssen stärker überwacht werden. In München gibt es unterirdische Regenrückhaltebecken, um das Kanalisationsnetz bei Starkregen zu entlasten und den Niederschlag zurückzuhalten. Zur Vorbereitung auf extreme Starkregenereignisse sei es aber zudem nötig, das Thema Versickerung und Regenwassermanagement in der Bauleitplanung stärker zu verankern.
Städte sind besonders ver…
Die Klimakrise findet global statt, doch auf lokaler Ebene gilt es sich an die Veränderungen anzupassen und Widerstand zu leisten. Am Beispiel Münchens berichten wir, wie sich eine Stadt anpasst und der Klimakrise entgegen wirkt