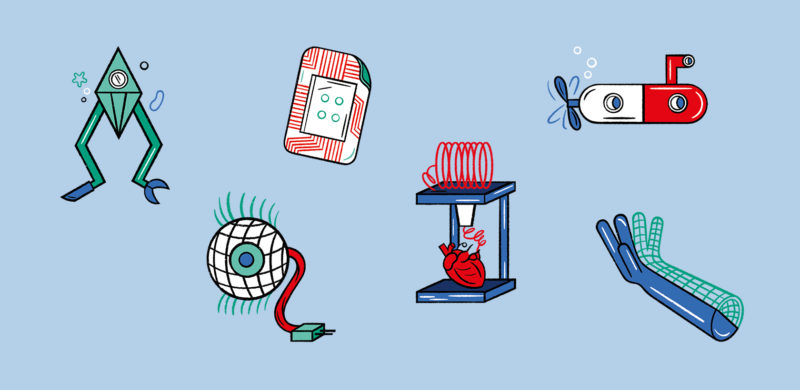Hegoi Belategi, 28, Spanien
„Kein Vertrag lief länger als einen Monat“
Als die Krise begann, war ich ein Teenager. Später, an der Universität, hatte ich ziemlich viel Glück: Ich komme aus einem Arbeiter*innenviertel in San Sebastián und habe in Bilbao studiert. Jedes Jahr habe ich ein staatliches Stipendium bekommen. Dadurch konnte ich fast kostenlos studieren – viele andere hatten diese Möglichkeit nicht. Während meines Studiums war meine Mutter eine Weile arbeitslos, mein Bruder verlor mehrmals seinen Job, mein Vater arbeitete viel weniger als zuvor. Auch ich hatte damals keinen richtigen Job. Vielen Familien ging es ähnlich. Zu Beginn der Krise versuchte die sozialdemokratische Regierung Spaniens, Schlüsselsektoren durch öffentliche Investitionen zu retten. Aber wegen wirklich fahrlässiger Entscheidungen verschlechterte sich die Situation weiter. Die nächste Regierung, eine konservative, setzte harte Reformen durch – aber scherte sich nicht darum, wie viele Menschen sie dadurch abhängte. Zwar ist es in den vergangenen Jahren leichter geworden, einen Job zu finden, doch die Gehälter sind nicht gestiegen – die Lebenshaltungskosten schon. Das Arbeitsrecht wurde geändert. Arbeitnehmer*innen haben jetzt weniger Rechte, sie können viel leichter entlassen werden. Unsere Wirtschaft ist heute vielleicht dynamischer, aber mehr Menschen leben in viel größerer Armut als vor 2008. Ich habe einen Bachelor in Journalismus und einen Master in Internationalen Beziehungen. Ich wusste, dass es schwierig sein würde, als Journalist gute Arbeit zu finden. Ich hatte viele verschiedene Jobs, bei denen ich nie mehr als 1.000 Euro verdient habe. Kein Vertrag lief länger als einen Monat. Während meines Bachelor-Studiums habe ich im Sommer in verschiedenen Restaurants gejobbt. Danach musste ich in einigen Medienhäusern erst mal kostenlos arbeiten, um überhaupt eine Chance zu haben. In den vergangenen drei Jahren hatte ich durchgehend Arbeit, etwa bei einer Lokalzeitung. Seit Juni bin ich Radiomoderator bei dem baskischen Sender Naiz Irratia.

Bild: privat
Auch bei Good Impact: Klimabürger*innenräte in ganz Europa – Warum Deutschland auch einen braucht
Giulia Dini, 28, Italien
„Die Zukunft liegt immer noch in meinen Händen“
Zum Zeitpunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 war ich 16 und vielleicht zu jung, um das Problem vollständig zu verstehen. Heute bin ich 28 und weiß: Die Krise war sehr tiefgreifend und ist es bis heute. Ein Problem waren die harten Sparmaßnahmen der EU und unserer Regierung. Regeln sind wichtig, aber das Schlüsselwort ist Gerechtigkeit, und nicht Gleichförmigkeit. Die EU ist eine Gemeinschaft, die sich aus vielen verschiedenen Staaten zusammensetzt. Wenn Regeln festgelegt werden, müssen Schwächen und unterschiedliche Rahmenbedingungen jedes Staates berücksichtigt werden. Das ist nicht passiert. Viele Menschen haben nach der Finanzkrise ihre Arbeit verloren, auch meine Eltern. Meine Mutter ist Psychologin und mein Vater hatte ein Elektrogeschäft, aber die Konkurrenz der Big Player war einfach zu groß. Für meine Generation ist es schwierig, einen Job zu finden. In den vergangenen Jahren wurde es zwar besser, aber jetzt hat die Coronakrise alles wieder infrage gestellt. 2011 habe ich zu studieren begonnen – und zwar das, was mich interessierte. Ich hatte gehofft, dass sich die wirtschaftliche Situation bis zu meinem Abschluss verbessert. Jetzt habe ich mein Studium abgeschlossen und bin auf Jobsuche. Nur wenige Unternehmen stellen gerade ein. Während des Studiums hatte ich einen Teilzeitjob im Bereich Kommunikation, zunächst nur für ein paar Stunden, später konnte ich immer mehr Aufgaben übernehmen. Wegen der Coronakrise ist damit jetzt Schluss. Politiker*innen versuchen, Jugendbeschäftigung zu fördern: Wer Menschen unter 30 Jahren einstellt, hat Steuervorteile. Ich habe davon bisher nicht profitiert. Es wird wohl schwierig sein, eine feste Arbeit mit angemessener Bezahlung zu finden. Doch ich bleibe optimistisch. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt und bin gerade mit meinem Freund zusammengezogen, weil ich denke: Die Zukunft liegt immer noch in meinen Händen. Ich will nicht, dass die Schwierigkeiten heute zur Ausrede werden, um sich dem Morgen zu verweigern.

Bild: privat
André Penha, 27, Portugal
„Mit Investmentbanking kann ich etwas bewirken“
Während der Finanz- und Wirtschaftskrise haben uns die Medien mit Informationen zur Finanzwelt bombardiert. Mich hat das neugierig gemacht: Ich wollte selbst im Bankensektor arbeiten. Doch als ich 2014 meinen Master in Finance abgeschlossen hatte, gab es kaum Stellen in Portugal. Ich hatte Glück und fand nach sechs Bewerbungen einen Job bei BNP Paribas CIB. Mittlerweile arbeite ich dort als Manager in der Abteilung für globale Märkte. Mein Team kümmert sich um Verträge für den Handel von Währungs- und Rohstoffderivaten zwischen Großkonzernen, Zentralbanken oder anderen Finanzinstituten. Mit Investmentbanking kann ich etwas bewirken: Ich bin Teil einer größeren Bewegung, die ethische, transparente Standards in der Branche etablieren will. Früher ist es manchmal dubios in dem Business zugegangen. Seit der Finanzkrise wird es besser. Manche Reformen, die aus finanzpolitischer Sicht sinnvoll schienen, waren schlecht für viele Menschen: Staatliche Investitionen wurden gekürzt, etwa Gelder für öffentliche Universitäten. In einer Krise ist es falsch, weniger in Bildung, Gesundheit und soziale Absicherungen zu investieren – genau dann braucht man ja ein stabiles Sozialsystem. Schaut man auf die Finanzindikatoren wie den Staatshaushalt steht Portugal inzwischen gut da. Trotzdem haben wir noch immer sehr niedrige Löhne und verhältnismäßig hohe Steuern. Meine Familie hat die Krise damals stark zu spüren bekommen: Mein Vater hatte ein Unternehmen im Messebau, viele seiner Konkurrent*innen gingen bankrott. Doch sein Unternehmen war klein genug, dass er seine Ausgaben radikal kürzen konnte – so hat er es durch die Finanzkrise geschafft. Aber jetzt bekommt er wegen Corona wieder keine Aufträge mehr. Zum Glück besitzen meine Eltern eine Wohnung, die sie vermieten können. Ich verdiene heute ziemlich gut. Aber für Berufsanfänger*innen ist es schwer. Mein Einstiegsgehalt hat damals auch nur gereicht, weil ich keine Miete zahlen musste: Ich konnte in einer Wohnung meiner Eltern leben. Vor zwei Jahren haben meine Frau und ich uns ein eigenes Haus gekauft, außerhalb von Lissabon. In der Stadt selbst könnten wir uns das nicht leisten. Im März kam unsere Tochter Mafalda zur Welt.

Bild: privat
Auch bei Good Impact: Globaler Alltag in der Pandemie: Namibia, Libanon und Spanien
Thomas Vasilakis, 41, Griechenland
„In der Eurokrise waren wir die Parias Europas“
Für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis die Blase platzte. Als Griechenland 2001 der Eurozone beitrat, gab es diesen übermäßigen Optimismus und die Illusion, dass wir zu den großen Volkswirtschaften gehören. Neue Einkaufszentren und Kreditkarten, die leichtsinnig ausgestellt wurden, ließen den Konsum explodieren. 2008 dann die Krise: Viele kleine Unternehmen mussten schließen, es gab Steuererhöhungen, unzählige Menschen begingen Suizid – es war ein großer Schock. Die Politik und die Sparmaßnahmen der EU haben uns das Gefühl gegeben, die Parias und Sündenböcke Europas zu sein. Einerseits waren manche Maßnahmen, die dem griechischen Staat auferlegt wurden, eine Erleichterung. Denn etliche unqualifizierte Leute waren damals nur wegen ihrer politischen Verbindungen im öffentlichen Sektor beschäftigt – teilweise ist das heute noch so. Andererseits haben etliche gesunde Unternehmen die Situation ausgenutzt und auf Kosten ihrer Mitarbeiter*innen gespart. Unter der Deflation haben wir alle gelitten. Ich hatte zum Glück keine Schulden, aber wir fühlten uns alle im freien Fall. Psychisch und in unserem Lebensstil. Vier Jahre lang war ich arbeitslos und habe illegal für wenig Geld gearbeitet. Das habe ich nur mithilfe von Freund*innen und meiner Familie durchgestanden. Heute unterrichte ich Englisch an einer Fremdsprachenschule und gebe zusätzlich Privatstunden für Englisch, Neuund Altgriechisch. Gelegentlich arbeite ich als Übersetzer. Die Krise von 2008 wirkt bis heute nach. Gerade schien sich die wirtschaftliche Situation zu erholen, da erschüttert die Coronakrise unsere Wirtschaft erneut und verstärkt die bestehenden Probleme. Wir schaffen es gerade so, über die Runden zu kommen. Es ist sehr schwer für mich, meine Zukunft zu planen, bei all den unerwarteten Dingen, die passiert sind. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, aus Griechenland auszuwandern. Aber diese Pläne hängen auch von meinem Lebensgefährten ab, der in einem anderen Land lebt. Auf jeden Fall denke ich ernsthaft darüber nach, meinen Beruf zu wechseln. Lehrer werden in Griechenland schlecht bezahlt.

Bild: privat
Dieser Text ist Teil des Schwerpunkts „Vergessene Geschichten – War da was?“ der Jubiläums-Ausgabe 06/20.
Zu Beginn der Eurokrise berichteten die Medien vor allem über Griechenland und einen möglichen „Grexit“ – den Austritt Griechenlands aus der Eurozone. (Symbolbild)