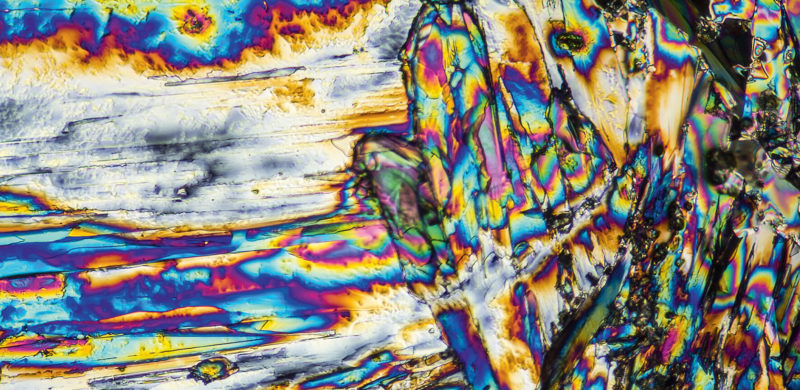In der Wissenschaft ist man fast nie ganz ungestört. Ständig unterbrechen Konferenzen, Papers, Büroarbeiten das Forschen, und dann möchte man ja auch noch Urlaub machen. Aber ausgerechnet kurz bevor Sylvia Kerschbaum-Gruber mit ihrer Familie in die Alpen fahren konnte, ist noch die Interview-Anfrage reingeflattert. Und so sitzt sie an einem Freitagvormittag im Juni noch eine weitere Stunde im Labor, einem Raum in Schattierungen von Weiß mit weißen Chemika-lienschränken neben der Tür, und während sie vor der Webcam sitzt und geduldig erzählt, huscht kurz noch ein weiß bekittelter Kollege rein und ist ebenso schnell wieder verschwunden.
Nun könnte man denken, Sylvia Kerschbaum-Gruber, Mensch, Mutter, Molekularbiologin an der Klinik für Radioonkologie der Medizinischen Universität Wien, hätte schon genug zu tun. Doch es gibt noch eine Sylvia – die mit Studien und Daten einen Kampf gegen Fake News in sozialen Medien führt. Die objektivste Methode, Wissen zu gewinnen, auf der einen Seite, die vermeintliche Gosse des Internets auf der anderen. Kann das funktionieren?
Wie Lügen Realität schaffen
Angesichts von Impfskepsis, Klimaleugner:innen und Populismus wird die Frage, wie Wissenschaft neues Vertrauen aufbauen kann, an Universitäten und Instituten immer lauter gestellt. Dass auch soziale Medien immer mehr in den Fokus geraten, liegt nahe: Sylvia Kerschbaum-Gruber hat auf Instagram etwa 20.000 Follower:innen. Ein großer Teil der Beiträge von @molecular.sylvia, wie sich Kerschbaum-Gruber im Internet nennt, dreht sich um Impfungen. Im Februar hat sie einige Videos über einen Evergreen der Impf-Lügen veröffentlicht: den Mythos eines Zusammenhangs zwischen Impfungen und Autismus. Der gründet auf gefälschten Daten aus den 1990ern, wurde seitdem vielfach widerlegt und doch immer wieder hochgespült. „Das ist bis heute einer der Hauptbeweggründe für Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen“, sagt Kerschbaum-Gruber.
Das alles macht Kerschbaum-Gruber unbezahlt neben ihrer Arbeit. Denn eigentlich bekämpft sie einen ganz anderen Gegner, den Krebs. Genauer gesagt den Pankreaskrebs, an dem viele Erkrankte sterben, weil sie lange keine Symptome zeigen. Deshalb wollen die Biolog:innen der Wiener Uniklinik für Radioonkologie das Immunsystem dazu bringen, den Krebs zu attackieren. Nur ist es mit den mutierten Zellen ein wenig so wie mit Fake News, die Ängste schüren und damit unser kognitives Prüfverfahren – namentlich das logische Denken – einfach überspringen. „Krebs hat die Eigenschaft, unser Immunsystem abzuschalten“, sagt Kerschbaum-Gruber.
Gestartet ist @molecular.sylvia, bevor Covid-19 den Globus überrollte. Damals war ihr primäres Ziel noch ein anderes: „Für mich war immer klar, ich möchte Wissenschaftlerin werden“, sagt sie. Doch als Kind habe sie kaum Vorbilder gehabt. „Ich habe nicht nur Einser in der Schule geschrieben. Für mich war es schwierig, mich für die Wissenschaft zu entscheiden. Wir haben immer diese Genies vor Augen: Albert Einstein, Stephen Hawking, Marie Curie. Mir hat es als Schülerin gefehlt, auch normale Menschen zu sehen.“ Diese Lücke habe sie füllen wollen, um jungen Menschen zu zeigen: „Das Einzige, was wir in diesem Beruf brauchen, ist Herzblut.“
Vorbehalte gegenüber Social Media
Trotz des Potenzials, das soziale Medien haben, um das Image der Wissenschaft zu verbessern, ist @molecular.sylvia eine von eher wenigen Forscher:innen im deutschsprachigen Raum, die in sozialen Medien aktiv sind. Ein Grund dafür dürfte sein, dass es in der Community …
Gute Wissenschaftskommunikation kann wie Rapunzels Haare den Weg in den Elfenbeinturm weisen.