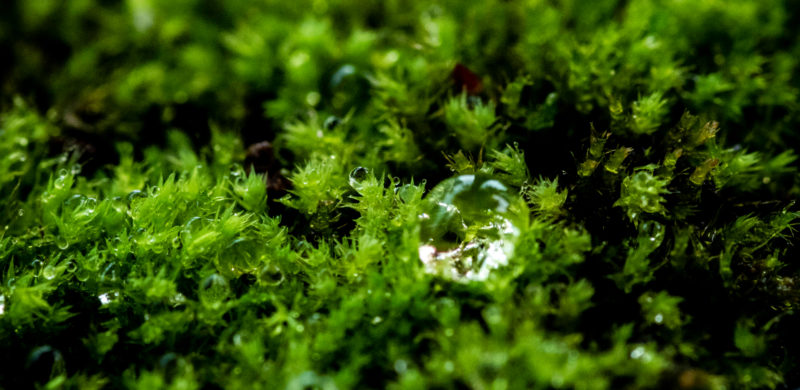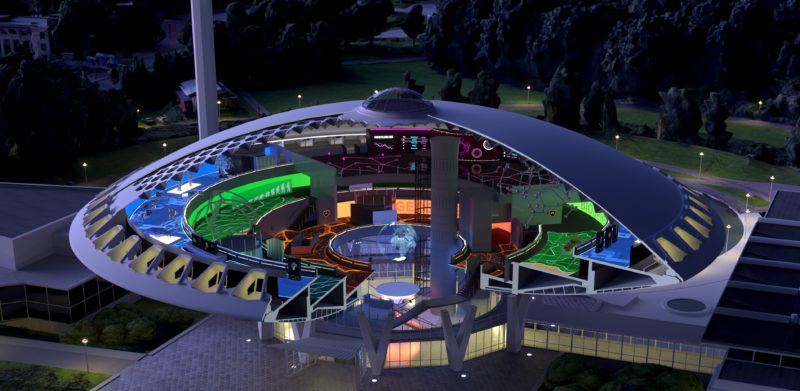So, ausgemacht und 35 Euro bezahlt. Es gibt kein Zurück, ich habe gerade mein erstes Social Dining gebucht. 18. November, 19 Uhr, koreanisches Barbecue in einer Hamburger Privatwohnung. Ich kenne weder Jinny, die Gastgeberin, noch ihren Freund Marc, in dessen Küche der Grillabend stattfindet. Auch die Gäste der beiden – außer mir hat sich bislang noch eine Person angemeldet – habe ich noch nie getroffen.
Das Prinzip Social Dining ist einfach: Ein Hobbykoch bietet auf einer Plattform ein privates Dinner an, in diesem Fall ist es „Chef One“ aus Hamburg. Der Koch lässt sich einen netten Speiseplan einfallen, zum Beispiel Wild-Variationen oder Köstlichkeiten à la Persische Nacht. Dann buchen ein paar wildfremde Menschen einen Platz an seinem Küchentisch, eine Art Blind Date in der Gruppe.
In der Kneipe isst man auch neben Fremden, manchmal sogar am selben Tisch, wenn wirklich kein anderer frei ist. Man redet dann aber nicht mehr mit den Tischnachbarn als „Sind da noch zwei Plätze frei?“ und einem hingemurmelten „Guten Appetit!“, wenn die ihr Essen bekommen. Ein Social Dinner hingegen will eine ganz andere Nähe herstellen, echte Begegnung schaffen, Unterhaltung anregen. Es geht für Gastgeber wie Gäste darum, sich aus der eigenen Filterblase zu bewegen.
Ein Schritt aus der Komfortzone
Super Idee. Und trotzdem eine etwas komische Vorstellung. Ich beschließe, lieber meinen Mann mitzunehmen. Drei Gäste sind wir jetzt. Ich bekomme eine Mail mit Jinnys Adresse; sie wohnt am anderen Ende der Stadt. Und hat nette Bewertungen von ihren bisherigen Gästen bekommen. Einen Tag vor dem Dinner ist das „Korean BBQ“ aus dem Angebot verschwunden. Sicher ausgebucht. Um 19 Uhr soll ich da sein, um 22.30 Uhr ist Schluss. Was zieht man da eigentlich an? Und bringt man Blumen mit?!
Ich gehe schließlich, lange Geschichte, doch alleine hin. Ohne Blumen, in Jeans. Jinny macht auf. „Lass die Schuhe ruhig an“, sagt sie, „das wird sonst zu kalt.“ Rechts ist die Küche, dort sitzen auf einer Bierbankgarnitur ihr Freund, ein weiterer junger Mann sowie drei junge Frauen. An der Wand hängen lustige Astra-Werbeplakate. Ich soll in der Mitte der hinteren Bank Platz nehmen. Auf mein Paar Stäbchen hat Jinny „Christiane“ auf koreanisch geschrieben.
„Sekt, Bier, Reiswein, Softgetränke, wir haben alles da“, sagt sie. Dann wirft sie den original koreanischen Tischgrill an, er steht direkt vor mir. Es wird mollig warm, Fett spritzt. Als Erstes kommt Bauchspeck auf den Rost, mit Pilzen und Zwiebeln, dann Rindfleisch unmariniert, später Rindfleisch mariniert, mit Birnen und Kiwis.
In Korea, erfahre ich, grillt man gerne, auch im Wohnzimmer auf dem Boden. Wir plaudern übers Kochen und Essen, Jinny erzählt und legt nach und legt nach. Sie ist eine entspannte Gastgeberin, das ist heute schon i…
Beim Social Dining lädt der Gastgeber eine Gruppe Fremder zum Essen in sein eigenes Wohnzimmer ein