Die Wunde unter seinem rechten Auge ist doppelt so groß wie eine Zwei-Euro-Münze. Tief und rot, fransig an den Rändern, vermutlich die Folge eines Kampfes. Der mächtige Orang-Utan im Regenwald von Sumatra greift zu den Blättern der Akar-Kuning-Liane, zerkaut sie, reibt ihren Saft in die Wunde und bedeckt seine Verletzung mit den Blattresten. Acht Tage lang wiederholt der Affe die Prozedur. Bis die Wunde vollständig verheilt.
Die Beobachtung, die ein Forscher:innenteam der indonesischen National University im Frühjahr 2024 im Fachblatt Scientific Reports veröffentlicht, ist eine Sensation. Ein Wildtier, das sich selbst verarztet? Das ist neu. Ob der Primat bewusst zu der Heilpflanze gegriffen oder zufällig gemerkt hat, dass sie entzündungshemmend wirkt, als seine Wunde mit dem Saft in Berührung kam, konnten die Wissenschaftler:innen zwar nicht sagen. Sicher ist: Der Affe behandelte seine Verletzung mit Bedacht.
Die Nachricht von der Selbstmedikation des Primaten im dunklen Grün von Sumatra ist ein Momentum, das zeigt, wie sehr wir Tiere bis heute verkennen. Gerade überschlagen sich die Meldungen von Verhaltensbiolog:innen aus aller Welt über die Fähigkeiten von wilden Tieren. Wildschweine befreien Artgenossen in Not. Fledermäuse pflegen Freundschaften. Kakadus klappern rhythmisch mit den Deckeln von Mülleimern, auf-zu-auf-zu, in regional unterschiedlicher Freestyle-Kultur. Und nicht nur Schimpansen, Elefanten und Schweine, sondern auch Delfine, Elstern, Pferde und sogar Putzerfische erkennen sich selbst im Spiegel.
Im April 2024 gingen 40 Forschende mit der New Yorker Erklärung an die Öffentlichkeit: Wir unterschätzen Tiere massiv. Manche haben vermutlich sogar eine Form von Bewusstsein. Ihr Plädoyer: Wir müssen sie endlich besser verstehen. Mehr respektieren. Besser schützen. Das Mensch-Tier-Verhältnis ganz neu bewerten. Was heißt das für Massentierhaltung und Zucht, für Forschung an Tieren, für Zoos, Haustierhaltung und unseren Umgang mit Wildtieren? Letztlich steht unser Selbstverständnis, die Frage nach dem Verhältnis zur Natur insgesamt auf dem Prüfstand.
Seit Jahrhunderten sieht sich der Mensch in der westlichen Welt nicht als Teil der Natur, sondern als ein ihr überlegenes Gegenüber. Der Blick auf das Tier als andere, minderwertige Kategorie ist verwurzelt in der Geistesgeschichte. Aristoteles sprach Tieren jede Vernunft ab, der französische Philosoph René Descartes bezeichnete sie als „Reflexmaschinen“ – Wesen, die auf Knopfdruck handeln wie Automaten. Immanuel Kant gestand ihnen weder Rechte noch Würde zu, Wesen ohne Vernunft schulde der Mensch keine Achtung, habe ihnen gegenüber keinerlei Pflichten.
Die Kirche und ihre Vordenker von Augustinus bis Thomas von Aquin verankerten dieses Denken religiös. Der Mensch als Krone der Schöpfung, geschaffen von Gott, fernab des Tierreichs. Und obwohl die Erkenntnis des Naturforschers Charles Darwin, der Mensch stamme aus dem Tierreich, diese Überzeugung erschütterte; obwohl immer wieder Philosophen wie der Brite David Hume an die Verbundenheit mit dem Tierreich erinnerten; obwohl Menschen in Landwirtschaft und Alltag eng mit Tieren zusammenlebten und sich vieler Fähigkeiten durchaus bewusst waren – der Mensch-Tier-Gegensatz blieb prägend und ist es im Kern bis heute. Der Philosoph Peter Singer spricht sogar von „Gattizismus“ – eine Form der Diskriminierung anderer Spezies durch den Menschen.
Und nun lösen die neuesten Forschungen diese vermeintlichen Gewissheiten mit einer Vehemenz auf, die Norbert Sachser als Revolution bezeichnet.
An einem Dienstagvormittag im Oktober sitzt Sachser in seinem Arbeitszimmer in Münster, hinter ihm lange Reihen von Aktenordnern. Sachser ist Verhaltensbiologe an der Universität Münster und zählt zu den bekanntesten Tierforscher:innen Europas. Nach Jahren in der Wissenschaft schreibt er nun als Seniorprofessor Bücher über seine Erkenntnisse, um die Menschen aufzurütteln. Das neuste mit dem Titel Das unterschätzte Tier. Sachser: „Die Revolution des Tierbildes ist so fundamental, dass sich die Gesellschaft, jede:r einzelne dringend damit auseinandersetzen sollte.“
Tiere können nicht kreativ denken? Von wegen. Nicht nur Affen, auch Seeotter, Delfine oder Rabenvögel stellen ausgetüftelte Werkzeuge her. Neukaledonische Krähen etwa brechen Zweige von Bäumen ab und formen mit dem Schnabel an ihrem Ende einen Widerhaken, um Futter aus Erdlöchern zu angeln. Um an eine Nuss zu kommen, die in einem mit Wasser gefüllten Reagenzglas schwimmt, spucken Orang-Utans ins Glas, damit sich der Wasserstand hebt und sie sich den Leckerbissen schnappen können. Schimpansen in Gabun legen sich eine Toolbox von Instrumenten zurecht, die sie nacheinander einsetzen, um an Honig zu gelangen. Eine Reihe von Arten, Kolkraben etwa, sind zum Perspektivwechsel in der Lage. Sie merken, wenn plünderfreudige Artgenossen sie beim Futterverstecken beobachten – und legen Fake-Vorräte an. Schweine, so fanden Rostocker Verhaltensforscher:innen heraus, meistern sogar das berühmte Marshmallow-Experiment, in der Psychologie ein Test für Selbstkontrolle: Je länger Kleinkinder ihre Schmacht auf ein süßes Zuckerschaum-Stückchen aufschieben können, wenn sie dafür später zwei Stücken bekommen, desto ausgeprägter ist bei ihnen diese Fähigkeit. In einem modifizierten Experiment konnten auch Schweine bis zu einer halben Minute ihre Lust bezwingen, wenn ihnen das noch saftigere Futterbrocken einbrachte. Von „unterschiedlichen Dimensionen der Intelligenz“ spricht der Wiener Kognitionsbiologe Ludwig Huber. Planen, Risiken abschätzen, Neues entwickeln etwa. „All diese Dinge können Menschen nicht ohne Bewusstsein tun – müssen wir daher nicht auch bei einigen Tieren von einer Art Bewusstsein ausgehen?“
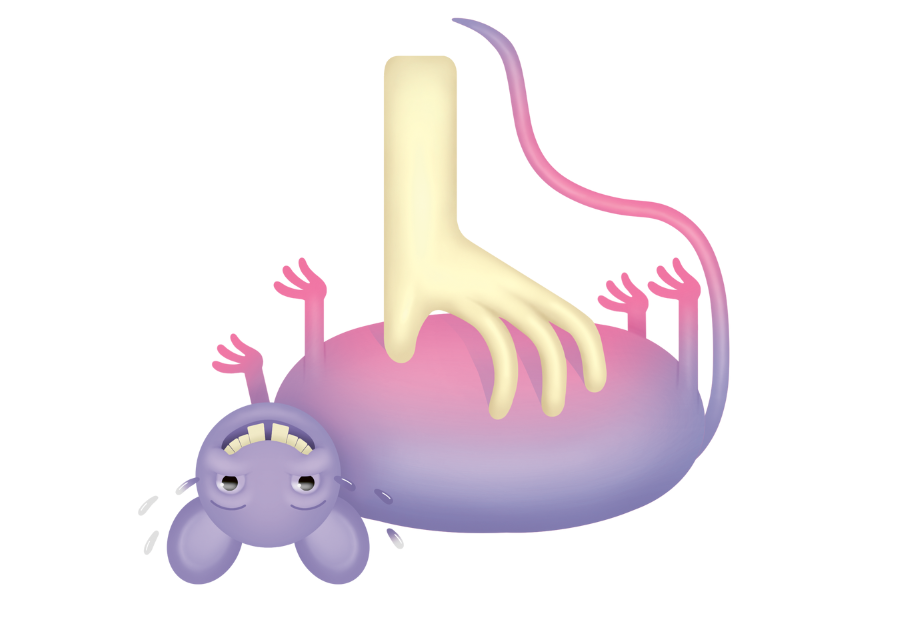
Tiere können nicht fühlen? Lange hieß es in der Verhaltensbiologie: Es fehlen uns wissenschaftliche Methoden, um das zu erforschen. „Um 2000 kam die emotionale Wende“, sagt Verhaltensforscher Sachser. Es sind zum einen die Neurowissenschaften, die Aufschluss bringen. Mit bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomografie (MRT) analysieren sie zum Beispiel das limbische System, also die Hirnregion, in der bei allen Wirbeltieren die Emotionen verarbeitet werden. Kitzelt man Ratten, glühen ihre neuronalen Schaltkreise vor Freude. Im Ultraschall hört man ihr scheinbar lautloses Lachen.
Um herauszufinden, wie Tiere Stress empfinden, wann sie sich wohlfühlen, wie ihr soziales Umfeld sie beeinflusst, messen die Forschenden Hormone wie Cortisol und Adrenalin. Zum anderen arbeitet die Wissenschaft heute mit einer Art Analogiexperiment, um auch komplexen Gefühlen wie Frust, Trauer und Empathie auf die Spur zu kommen. „Dabei wird das Verhalten von Tieren in Situationen erfasst, von denen wir wissen, welche Emotionen sie beim Menschen auslösen“, so Sachser. „Dann schauen wir: Gibt es ähnliche Muster beim Tier?“ Kapuzineraffen zum Beispiel haben einen Sinn für Fairness, Schimpansen und Wildschweine trösten gemobbte Artgenossen.
Tiere sind mehr Instinkt als Persönlichkeit? Keineswegs. Natürlich spielen Schlüsselreize eine Rolle. Die Spinne denkt nicht nach, wenn sie ihr Netz webt. Der Stichling attacktiert intuitiv Dinge mit roter Unterseite. Doch schon im Mutterleib wird je nach Hormonhaushalt die Gehirnentwicklung geprägt. Werden Jungtiere nach der Geburt vernachlässigt, fehlen Sozialpartner, können sie Verhaltensstörungen entwickeln. Machen sie gute Erfahrungen, wachsen sie eher zu Optimisten heran. Ähnlich wichtig ist die Jugend. Lernen Meerschweinchen-Teens das Sozialverhalten in Auseinandersetzung mit den Anführern des Rudels, sind sie im Erwachsenenalter friedlicher als Tiere, die ihre Frühzeit in Einzelhaltung verbringen. Sachser: „Wie wir Menschen bilden Tiere im Zusammenspiel von Genen, Umwelt und Sozialisation einmalige Charaktere aus.“
Das Faszinierende daran: Nicht nur Säugetiere, sondern auch Vögel, Oktopusse, Fische und Insekten sind zu viel mehr in der Lage, als wir lange dachten, betont Ludwig Huber, Leiter des Forschungsinstituts für Mensch-Tier-Beziehungen an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Dass Fische Schmerz empfinden können, ist längst Konsens. „Aber es gibt auch Belege für komplexe kognitive Leistungen.“ So verstehen Putzerfische schneller als Schimpansen, woher sie in kniffligen Versuchen das meiste Futter bekommen. „Bienen scheinen die Konsequenzen ihrer Handlungen abschätzen zu können und sind Meister des sozialen Lernens, obwohl ihre Gehirne gerade mal einen Kubikmillimeter groß sind und nicht mehr als 960.000 Neuronen haben (der Mensch: 2,3¹⁰)“, so Huber. Hummeln kopieren spontan das Verhalten ihrer Peers, wenn sie sehen, dass Artgenossen Futter bekommen, sobald sie Grasbällchen in ein Loch rollen lassen. Manche scheinen gar mit den Bällchen zu spielen, schreibt Hubers Kollege Lars Chittka in seinem 2024 ersch…
Die Wissenschaft stellt unser Tierbild auf den Kopf. Pferde, Raben oder Ratten etwa können mehr als wir denken. Und jetzt?






