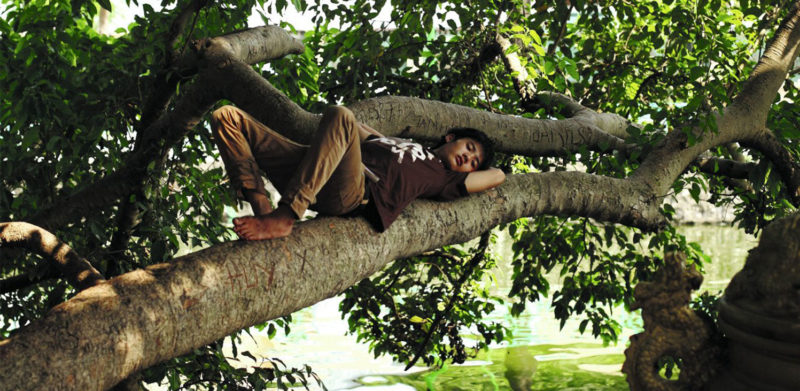Als Rumbidzai Gwinji die Zimbaqua-Mine zum ersten Mal besucht, weiß sie sofort: „Ich will Teil davon sein.“ Sie sieht, wie Dutzende Frauen in einer Grube nach Aquamarinen schürfen. Andere kümmern sich um die Beete im anliegenden Garten. Eigentlich war Gwinji in den ländlichen Norden Simbabwes gereist, um die Arbeiterinnen der Mine zu schulen. Sicherheit und Nachhaltigkeit im Bergbau stehen auf dem Lehrplan. „Aber dann war ich diejenige, die in diesen Tagen in der Mine am meisten gelernt hat“, sagt Gwinji heute: über Zusammenhalt und den Wert von Unabhängigkeit als Frau und Mutter. Kurzerhand bewirbt sie sich um eine feste Stelle als Koordinatorin bei Zimbaqua. Sie bekommt sie. Seither zählt Gwinji zum Team der ersten Mine Afrikas, in der ausschließlich Frauen arbeiten.

Bild: Iver Rosenkrantz / Zimbaqua
Zwei Männer haben das Edelsteinbergwerk Zimbaqua gegründet. „Wir haben den konventionellen Bergbau auf den Kopf gestellt“, sagt Unternehmer Patrick Tendaye Zindoga. Mit seinem dänischen Geschäftspartner Iver Rosenkrantz kaufte er vor drei Jahren etwa 50 Hektar Land in der Karoi-Region. Vor Ort suchten sie immer wieder das Gespräch mit den Anwohner:innen. „Es war offensichtlich, dass es für die Frauen dort keine Perspektiven gab“, sagt Rosenkrantz. Einige schürften auf eigene Faust nach Edelsteinen. Andere arbeiteten auf einem Acker; ernteten Mais und Tabak. Die meisten jedoch waren arbeitslos und, falls sie verheiratet waren, abhängig vom Lohn ihrer Männer. Zindoga und Rosenkrantz wollten das ändern.
30 Arbeiterinnen beschäftigt Zimbaqua inzwischen. Mit ihrem Bachelor in „Environmental health and safety“ ist die Minen-Koordinatorin Gwinji eine Ausnahme. Die meisten Arbeiterinnen haben keinen Schulabschluss und keine Erfahrung im Bergbau. In Simbabwe ist Bildung schon früh eine Geldfrage. Selbst staatliche Schulen verlangen einen Beitrag. „Manchmal konnte ich die Schulgebühren für meine Kinder nicht bezahlen“, erzählt Anatolia Mapfumo. Heute arbeitet sie als Managerin bei Zimbaqua. Früher ging sie Goldwaschen, mit spärlichen Erträgen. Wann immer das Geld nicht reichte, mussten ihre drei Kinder zu Hause bleiben. Eine Schulpflicht gibt es in Simbabwe nicht. So entsteht ein Teufelskreis: kein Geld, keine Bildung, kein Job, kein Geld. Zindoga und Rosenkrantz wollen diesen Teufelskreis durchbrechen.
„Simbabwe lernt, seine eigenen Ressourcen zu verwalten“
Dahinter steckt keine bloße Wohltätigkeit, sondern eine ausgefeilte Strategie. „Wir wollen der Gemeinde etwas zurückgeben“, sagt Zindoga. Er sagt aber auch: „Es ist ein Geschäftsmodell, wir wollen damit Profit machen.“ Für ihn ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil: Er sieht es als einzige Möglichkeit, die Entwicklung seines Heimatlandes erfolgreich voranzutreiben. Wenn westliche Unternehmen nach Afrika kämen, sei das häufig anders. Dann stehe oft einzig der Gewinn im Vordergrund, und die Einwohner:innen müssten zurückweichen.
In der Kolonialzeit war der Bergbau immer eine tragende Säule. Europäische Konzerne ließen die Rohstoffe meist von billigen Arbeitskräften schürfen – und verkauften sie zu hohen Preisen ins Ausland. Was der lokalen Bevölkerung vom Ressourcenreichtum blieb, war häufig nicht mehr als Hungerlöhne und zerstörtes Land. „Simbabwe lernt gerade erst, seine eigenen Ressourcen zu verwalten“, sagt Zindoga. Schließlich hätte der Westen Hunderte Jahre Vorsprung, und lange haben die kolonialen Strukturen die Entwicklung verhindert. Simbabwe ist erst seit 1980 offiziell unabhängig. Zindoga war damals ein Jahr alt. Es war eine verheißungsvolle Zeit, die Wirtschaft wuchs zunächst stark.
Heute ist Simbabwe eines der ärmsten Länder der Welt. Jahrzehnte unter der Herrschaft des Machthabers Robert
Mugabe haben Spuren hinterlassen. Die Infrastruktur ist marode; Exportrestriktionen erschweren den Handel mit dem Ausland. Auch nach Mugabes Sturz im Jahr 2017 blieb der erhoffte Wand…
Fair bezahlte Arbeit und eine echte Perspektive: Sharon Kasoka präsentiert stolz ihren geschürften Aquamarin. Sie ist eine der 30 Zimbaqua-Minenarbeiterinnen in Simbabwe.