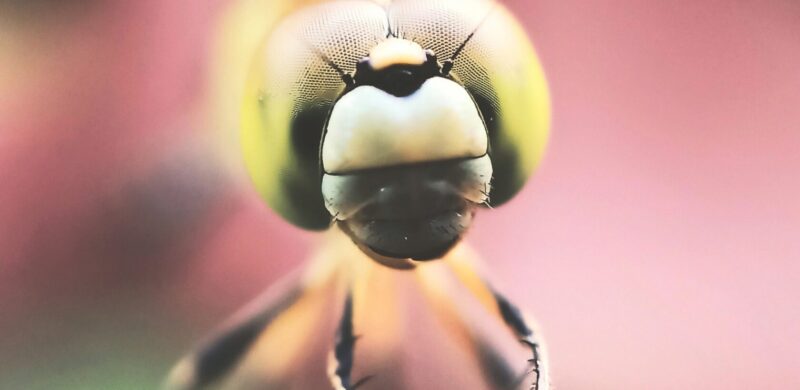Kennt ihr Vatersprachen? Den Begriff gab es früher tatsächlich. „Lingua patrius“ nannte man im Mittelalter das Latein der Gelehrten. Die Alltagssprache der Massen grenzte man davon ab: „lingua materna“, Muttersprache. Als Martin Luther die Bibel übersetzte und sich Deutsch auch als Wissenschaftssprache verbreitete, verlor die Unterscheidung an Bedeutung. In den meisten europäischen Sprachen setzte sich der Begriff Muttersprache durch – doch er enthält Vorstellungen, die nicht unproblematisch sind.
Denn das Wort Muttersprache legt nahe, dass eine Sprache unveränderlich und angeboren ist, wie die Abstammung von der eigenen Mutter. Damit bestärkt sie das traditionelle Bild der Frau als Sorgearbeiterin sowie ihre Aufgabe, den Kindern die Sprache beizubringen, die sie bereits im Mutterleib gehört haben. Dass Kinder Sprachen auch von anderen Bezugspersonen lernen, wenn sie etwa mit zwei Vätern aufwachsen oder weil in ihrem alltäglichen Umfeld außerhalb der Familie eine andere Sprache gesprochen wird, verschleiert der Begriff.
Die Abstammungsvorstellung umfasst aber noch mehr. In den meisten Ländern nennen Menschen ihr Geburtsland Vaterland. Der Begriff erlebte besonders im frühen 19. Jahrhundert einen Boom, um ein nationalistisches Selbstverständnis zu prägen. Vaterland und Muttersprache bilden dieser Vorstellung nach eine feste Einheit. Darin bleibt wenig Platz für Mehrsprachigkeit und Pluralismus: Wenn ich etwa türkischsprachig in Deutschland aufgewachsen bin, gehöre ich in dieser Lesart nicht dazu – selbst wenn ich fließend Deutsch spreche und es als meine Muttersprache bezeichnen würde. Nach dieser Auslegung gehört nur zur Gemeinschaft, wer in die Landessprache hineingeboren wurde. Die Folgen? Abwertung anderer Sprachen, soziale Ausgrenzung, Benachteiligung in Schule und Beruf. Diese Sprachvorstellung mündet in einem unfairen Machtverhältnis.
Doch welche Alternative gibt es? Sprachwissenschaftler:innen reden von Erstsprache statt von Muttersprache, da diese Definition präziser ist. Denn Erstsprache bezieht sich nur auf die Reihenfolge und den Kontext, in dem sie erlernt wurde. Erstsprachen lernen kleine Kinder von ihrem nächsten Umfeld, etwas später kommen Zweit-, Dritt-, Viert-Sprachen dazu. Durch die natürliche Sprachumgebung im Alltag oder auch in der Schule. Eine Erstsprache muss nicht jene sein, die man am besten beherrscht oder in der man sich am wohlsten fühlt. Welche das ist, entscheidet jede:r selbst
Der Begriff Muttersprachen enthält oft Vorstellungen, die nicht unproblematisch sind. Welche Alternativen gibt es?