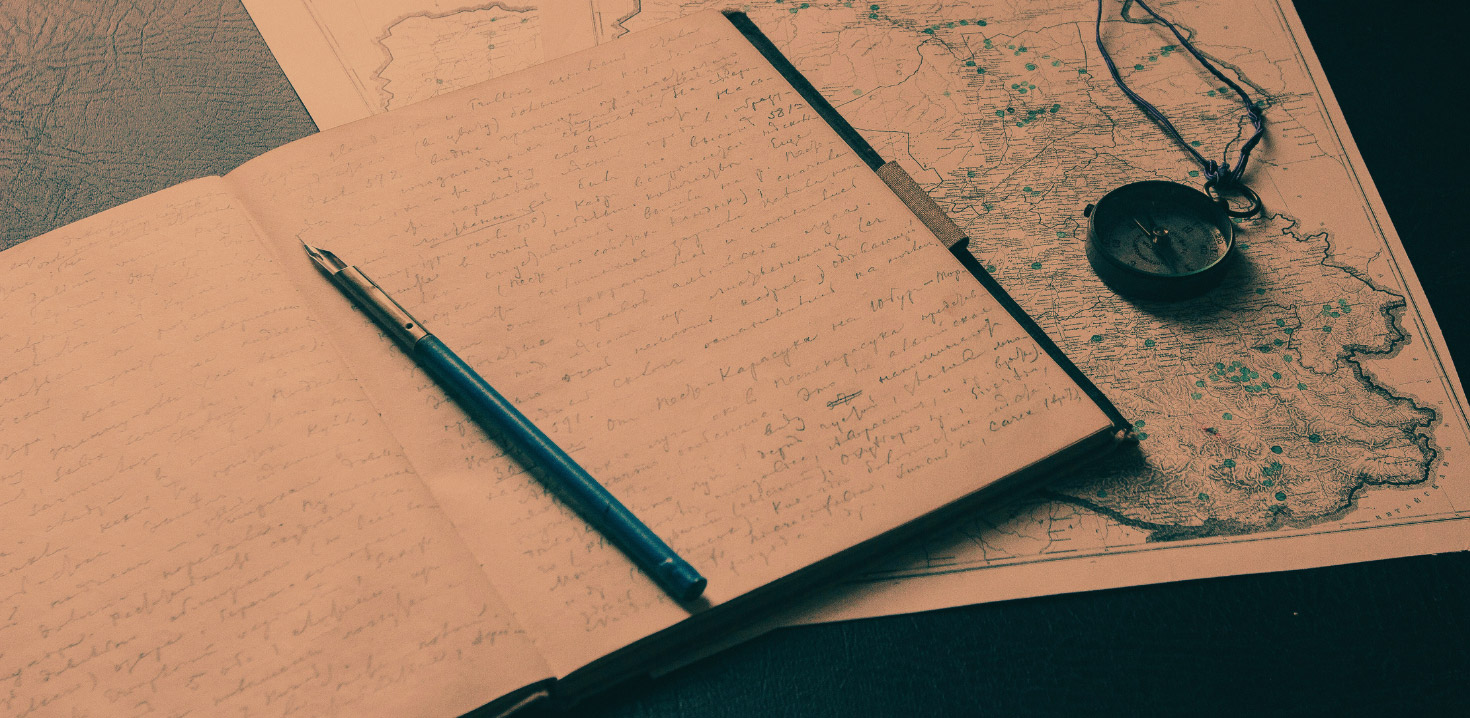„Wir sind raus“
Nach dreißig Jahren kehrt der deutsche Ökonom Matthias Doepke den USA den Rücken – aufgegeben hat er sie aber noch nicht.
Ein Vorort von Chicago, USA, April 2022. Matthias Doepke steht zwischen etlichen Koffern, seine Gedanken rasen, der Puls geht schnell, in zwei Transportboxen die beiden Katzen, bereit zum Abflug. Für den deutschen Ökonomen geht ein Leben zu Ende. Ein Teil des Hausstands fliegt mit nach London, der Rest folgt per Schiff.
Der amerikanische Traum? Zerplatzt. „Bis vor Kurzem hätte ich nie gedacht, dieses Land je verlassen zu müssen“, sagt Doepke bei einem Videocall. Er sitzt in seinem Büro an der London School of Economics, trägt ein blaues Polo-Shirt. Auf dem Regal hinter ihm: Familienfotos. Wenn er spricht, eilen die Gedanken den Worten voraus. Er redet schnell, manchmal stockend, wie aus dem Englischen rückübersetzt. Kein Wunder – mehr als 30 Jahre hat er in den USA gelebt und geforscht. Dennoch wirkt er gefasst. „Es war die richtige Entscheidung.“ Doepke wächst in einer niedersächsischen Kleinstadt auf, später studiert er VWL in Berlin. Mit einem Fulbright-Stipendium schafft er es in die USA. „Englisch war in der Wissenschaft immer wichtig, das Land hat mich fasziniert.“ Besonders beeindruckt ihn die Offenheit gegenüber Einwander:innen.
Ein neues Zuhause
Aus dem Austausch wird ein neues Zuhause. Bald ist klar: Er will in die Forschung und beginnt ein PhD-Programm an der University of Chicago. Dort ist die Arbeit intensiver und zugleich freier als in Deutschland. „Dort wäre ich als Assistent irgendwem zugeordnet worden, hätte nichts gelernt.“
Doepke bleibt in den USA: zehn Jahre an der UCLA in Kalifornien, 15 Jahre an der Northwestern University in Chicago. Kolleg:innen aus Südamerika, Europa und Asien – die offene Forschungskultur gefällt ihm. 2014 wird er US-Staatsbürger. „Ein schönes Gefühl, auch offiziell dazuzugehören.“ An der Universität in Chicago entdeckt er seine Leidenschaft für Familienökonomie. Sein Schwerpunkt: Gleichstellung und Erziehung. Als Vater von drei Söhnen kann er auch privat davon profitieren. In seinem Buch Love, Money, and Parenting beschreibt er die „Erziehungskluft“ zwischen armen und reichen Familien, warum wirtschaftliche Unsicherheit Eltern eher zu Helikoptern macht.

Dann wird Donald Trump 2017 Präsident – und etwas kippt. Muslimische Kolleg:innen werden angefeindet, Wissenschaftler:innen diffamiert. Noch vor der Wahl 2020 beschließt die Familie: „Wenn Trump noch mal gewinnt, sind wir raus.“ Doepke ruft Kolleg:innen in Europa an, verschickt Bewerbungen.
Es wird Joe Biden – Doepke bleibt, aber seine Sorge geht nicht. „Die moderaten Republikaner sind verschwunden. Wenn sie wieder an die Macht kommen, wird es jemand aus dem Trump-Lager sein.“ Dann schießt in Highland Park, unweit seines Wohnorts, ein Teenager an einer Tankstelle um sich. In der Schule seiner Kinder werden Waffen gefunden. „Das war zu viel.“ 2022 zieht die Familie nach London. Doepke übernimmt eine Professur an der London School of Economics (LSE). Noch hat er einige Projekte in den USA, pendelt zwischen den Ländern.
Wortverbote und Budgetstreichungen
Drei Jahre später, wieder Trump. Der lässt im März Hunderte Wörter aus offiziellen Dokumenten entfernen, darunter „equality“, „diversity“ und „gender“ – zentrale Begriffe in Doepkes Forschung. „Für diese Themen gibt es heute keine Gelder mehr.“ Freie Forschung? Kaum noch möglich. Im Mai schreibt Doepke auf Bluesky: „Wir haben unser Haus verkauft. Das hier ist kein Ort mehr, um eine Familie großzuziehen und eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen.“
In London berät er regelmäßig Kolleg:innen, die gehen wollen, meist jüngere – sie haben ihre Karriere noch vor sich. „Das ist die größte Gelegenheit seit dem Zweiten Weltkrieg für Europa, als wissenschaftlicher Standort zu wachsen.“ Es gehe nicht nur um Geld, sondern um Haltung. „Forschung braucht Stabilität über Legislaturperioden hinaus.“ Die sieht er in den USA erst mal nicht.
Ganz aufgegeben hat er die USA aber nicht. „Wer hätte 1998 gedacht, dass zehn Jahre später ein Schwarzer Präsident wird?“ Die Wandlungsfähigkeit der USA stimmt ihn hoffungsvoll – und der Glaube, dass auch diese dunkle Phase vorübergeht.
„Ohne Menschlichkeit ist Wissenschaft nichts“
Encieh Erfani war Physikprofessorin im Iran. Während der „Frau, Leben, Freiheit“-Aufstände vor drei Jahren kündigte sie aus Protest , floh nach Kanada. Heute ist sie Mentorin für geflüchtete Forschende.
Die Sterne hat sie mitgenommen, alles andere musste Encieh Erfani zurücklassen. Damals, als kleines Mädchen, sieben oder acht Jahre alt, lag sie oft im Garten ihrer Großeltern in Täbris – eine der ältesten Städte im Osten des Irans, bekannt für ihre handgeknüpften Teppiche. Über Erfani spannte sich ein Himmel, wie sie ihn zuvor nie gesehen hat: kaum Licht, keine Flugzeuge, nur Dunkelheit – und Sterne. Tausende winzige, funkelnde Punkte. „Ich wusste: Da draußen ist etwas, das größer ist als alles, was ich kannte“, sagt Erfani. Sie wollte herausfinden, was. Jahre später wird sie Astrophysikerin. Und muss deshalb ihr altes Leben aufgeben.
Zum Videocall erscheint Erfani in einer weißen Bluse, die braunen Haare locker mit einem Stirnband zusammengebunden. Eine kleingewachsene Frau, die klar, laut, entschlossen spricht. Gerade lebt sie in Waterloo, Kanada, doch Ende des Jahres läuft ihr Visum ab. Sie vermisst ihre Familie. „Ich bin müde. Seit meiner Flucht vor ein paar Jahren springe ich von Land zu Land“, sagt Erfani. Zurück in den Iran kann sie nicht, da droht ihr eine Haftstrafe oder Schlimmeres. Doch ihre Entscheidung hat sie nie bereut: „Es lohnt sich immer, für Freiheit und Wissenschaft zu kämpfen.“
Leben in einer Diktatur
Erfani wächst in einer traditionellen iranischen Familie auf. Kopftuchtragen gehört dazu, auch zu Hause. Sie ärgert sich, weil ihr jüngerer Bruder länger draußen bleiben und spielen darf. Einen Freund darf sie nicht haben. „Das sind eben die Regeln“, sagen ihre Eltern. „Ich habe erst viel später verstanden, dass wir in einer Diktatur leben“, sagt Erfani. In der Schule schreibt sie gut…
Scartchbook für die Flucht: Wohin, wenn Wissenschaft in Gefahr ist?