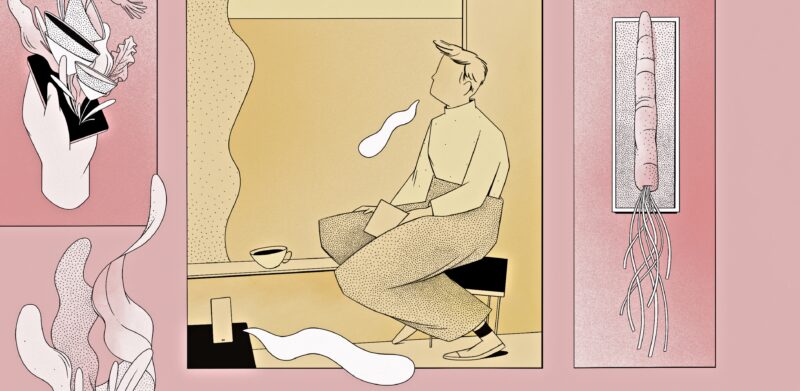1) Hashtags nutzen
Text von Rahel Lang
Digitaler Aktivismus wie das Verbreiten von Online-Petitionen wird oft als Faulpelzaktivismus verspottet. Denn was verändern Klicks im Internet schon in der realen Welt? Die Kommunikationspsychologin Hedy Greijdanus von der Universität Groningen und ihre Co-Autor:innen zeigen in einer Arbeit zur Psychologie des Internet-Aktivismus: „Vieles spricht für positive Beziehungen zwischen Online- und Offline-Aktivismus.“
Was Online-Aktivismus auslösen kann, zeigt etwa die „Black Lives Matter“-Bewegung. Sie startete zunächst mit einem Hashtag im Internet. Als im Sommer 2020 ein Video viral ging, das die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt zeigt, kam es zu großen Straßenprotesten in vielen US-Bundesstaaten und zahlreichen anderen Ländern. Das Teilen des Videos in den sozialen Medien hatte Menschen auf die antirassistische Bewegung aufmerksam gemacht und für Demonstrationen mobilisiert. Darin liegt der Schlüssel zum Erfolg: das Internet als dezentralen Ort zu nutzen, um Interessen zu bündeln und in die Welt hinauszutragen.

Digitaler Aktivismus ist dabei mehr als die Verbreitung von politischen Inhalten und das Unterzeichnen von Online-Petitionen. Es geht auch darum, Informationen bereitzustellen – als Grundlage für politische Forderungen. Diese Arbeit ist Teil der Open-Data- und Open-Government-Bewegung. Die Plattform FragDenStaat beispielsweise erleichtert es, Auskünfte von staatlichen Behörden zu bekommen. Einfach die Anfrage auf die Website der Plattform stellen; FragDenStaat leitet sie weiter und veröffentlicht anschließend die Antwort. Wenn du also einen Blick auf interne Protokolle, Briefwechsel zwischen Politiker:innen oder Baupläne eurer Stadt werfen willst, frag doch einfach mal nach.
Das Crowdsourcing-Projekt #everynamecounts, „Jeder Name zählt“, arbeitet derzeit am weltweit größten Online-Archiv über die Opfer und Überlebenden des Nationalsozialismus. Das Projekt ist eine Initiative der Arolsen Archives, eines internationalen Zentrums für NS-Verfolgung. Bis 2025 sollen die Namen der Opfer in eine digitale Datenbank aufgenommen werden, ein virtuelles Denkmal. Dafür werden auf der Website eingescannte historische Karteikarten angezeigt, die Freiwillige abtippen und digitalisieren. Jede:r kann mitmachen. Online-Aktivismus ist also vieles – aber sicher nichts für Faulpelze.
2) Paroli bieten
Text von Miriam Petzold
Stell dir vor, du bist im Supermarkt. Du schiebst deinen Wagen zur Kasse, reihst dich in die Schlange ein. Vor dir hörst du jemanden sagen: „Beim Einkaufen sieht man nur noch Ausländer.“ (Wie) würdest du darauf reagieren?
So beginnen die sechsstündigen Stammtischkämpfer:innen-Seminare gegen rechte Parolen vom Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“. Sie sind solidarisch finanziert und werden etwa von Gewerkschaften, Parteien, religiösen Verbänden oder Stadtverwaltungen angefragt. Die Teilnahme ist kostenlos. „Unser Ziel ist es, dass keine diskriminierende Aussage, die Menschen im Alltag mitbekommen, unwidersprochen bleibt“, sagt Christian Schneider, der die Workshops koordiniert. Die Teilnehmer:innen lernen, die „Schrecksekunde“ zu überwinden – dieses Ziehen in der Magengrube, der Knoten im Hals, Wut und Angst, wenn in der Nähe ein menschenverachtender Spruch fällt.
Hemmnisse, zu reagieren, gibt es viele. Sie reichen von der netten, vertrauten Stimmung beim Familiendinner bis zum Zeitmangel in der U-Bahn und zu Hierarchien bei der Arbeit. Hemmen kann auch das Gefühl, zu wenig Fakten parat zu haben oder in der Unterzahl zu sein. Wer solche Barrieren erkennt, kann sie durchbrechen. „Wenn ich Angst davor habe, eine Beziehung zu gefährden, muss ich davon ausgehen, dass das Bedürfnis auf der anderen Seite auch besteht. Und ich kann mich darauf beziehen.“ Wenn Sätze fallen, in denen Ängste stecken („Ich hätte schon ein Problem damit, wenn nebenan Geflüchtete unterkommen“), ist erst mal Empathie gefragt. Schneider: „Auch wenn der Grund für die Angst nicht real ist, die Angst selbst ist es trotzdem.“ Also: Emotionen ernst nehmen („Was macht dir denn Angst?“), weg von „du musst“, hin zu „Lass uns doch gemeinsam mal so eine Unterkunft besuchen“. In manchen Momenten kann sogar Zustimmung helfen. Wer Dinge sagt wie: „Bettelnde Obdachlose sollten aus der Fußgängerzone entfernt werden“, lässt sich überrumpeln mit: „Ja, ich finde auch, so sollte niemand leben müssen. Die sollen alle eine Wohnung bekommen.“
Am Ende des Seminars ist den Teilnehmenden klar: Es gibt keine Patentlösung, jede Situation ist anders. Manchmal ist es ratsam, sich zu positionieren – ohne zu diskutieren –, etwa in der Schlange zur Supermarktkasse („Solche Sprüche will ich mir nicht anhören, beim nächsten Mal gehe ich in eine andere Filiale“). Manchmal macht es Sinn, Verbündete zu suchen oder den Raum zu verlassen. „Selbst bei Nazi-Rhetorik kommen die wenigsten auf die Idee, zu gehen. Dabei wäre das eine angemessene Reaktion“, so Schneider.
3) Das Megafon schnappen
Text von Charlotte Köhler
Du reißt einen alten Pappkarton auseinander, nimmst dir die größte Fläche, greifst zum Edding und setzt ein Statement. Dann gehst du raus auf die Straße; ihr seid Hunderte, Tausende. Eure Parolen sind einstudiert, die Straßen gesperrt, gemeinsam seid ihr laut – aber seid ihr gemeinsam stark?
Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, sagt die Politikwissenschaftlerin Nina-Kathrin Wienkoop vom Inst…
Eine Form des Protests: Politische Slogans lautstark auf die Straße bringen.