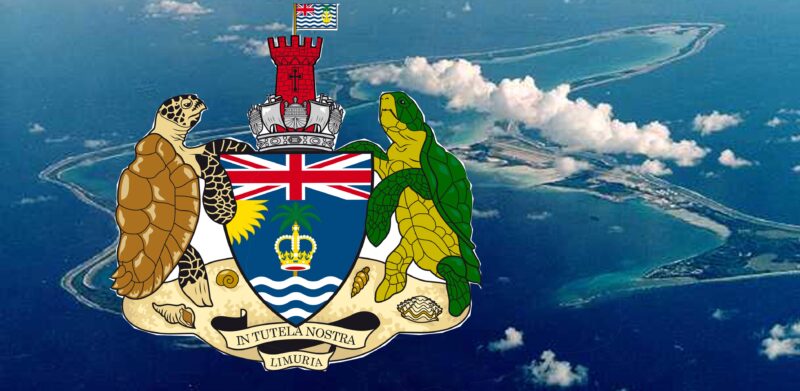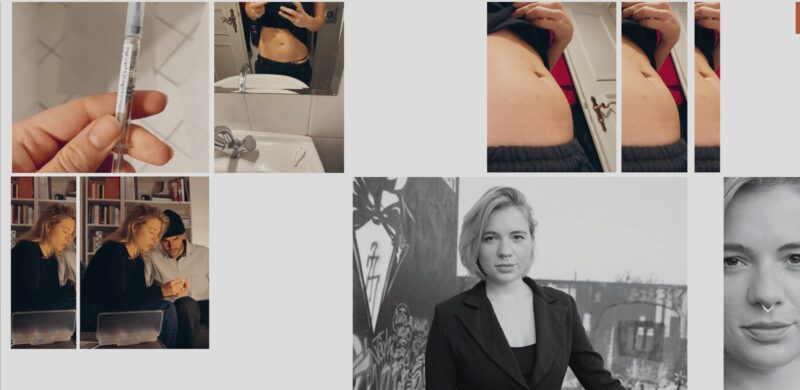Die Niederlande sind eine leer gepumpte Badewanne. Um die Wanne herum steht das Wasser. Und der Pegel steigt. Machen wir so weiter, sagte der Geologe Maarten Kleinhans 2023 der niederländischen Zeitung Volkskrant, schaufeln wir unser eigenes Seemannsgrab. Zweifelsohne ein schönes, eindrucksvolles. Kleinhans ist einer der wenigen, der sich dennoch traut, laut Stopp zu rufen.
Die Natur hier ist rechteckig, feinste Handarbeit. Schmale Wasserläufe trennen die saftig grünen Parzellen. Auf manchen stehen Kühe, auf manchen Häuser, jede hat eine Funktion. Alles andere wäre Verschwendung. Das Land hat man sich hart erarbeitet.
Vor tausend Jahren bestand knapp die Hälfte der Fläche aus unwegsamen Torfmooren. Ein Ort, weder Wasser noch Land, sondern irgendwas dazwischen. Bis zum Mittelalter traute sich kaum jemand hinein in den Sumpf, nicht einmal die Römer.
Der Wasserwolf lauerte überall. So hießen Seen und Sümpfe im Volksmund. Sie stahlen nicht nur Platz für Viehzucht und Nutzpflanzen, sondern liefen oft über, verwüsteten Siedlungen. Also: Krieg dem Wasserwolf. Gräben wurden ausgehoben, in denen das Wasser abfließen konnte, Windmühlen zum Pumpen gebaut, Schleusen und Deiche errichtet, um das Meerwasser zu zähmen. So wurden große Teile des Westens und Nordens zu Poldern: trockengelegte Gebiete, in denen der Wasserstand künstlich niedrig gehalten wird.
„Gott schuf die Erde, aber die Niederländer:innen schufen die Niederlande“, heißt ein viel zitiertes Sprichwort aus dem 17. Jahrhundert. Der darin schwellende Stolz formt bis heute die Identität der Niederländer:innen, stimuliert Zusammenarbeit – aber blockiert auch effektiven Klimaschutz, sagt Lotte Jensen, Kulturhistorikerin an der Radboud-Universität in Nijmegen und Autorin des Buches „Water: A Dutch Cultural History“.
„Laat de zee maar komen“, lass das Meer ruhig kommen – wenn wir es nicht bezwingen können, schafft es niemand. Am Amsterdamer Flughafen werden Reisende mit einem riesigen Billboard begrüßt: Welcome below sealevel.
„Wir verkaufen uns als beste Wasserbauer:innen der Welt“, so Jensen. Die 13 Deltawerke, gigantische Tore zur Nordsee, die Küstenstädte wie Rotterdam vor Sturmfluten beschützen, gelten unter Ingenieur:innen als siebtes modernes Weltwunder. Die beiden Tore der Maeslantkering etwa messen jeweils 210 Meter und sind geschlossen breiter als der Eiffelturm in Paris hoch. Der Beemster-Polder von 1612 ist Unesco-Weltkulturerbe und Touri-Magnet. Landschaftskundler:innen nennen solche Flächen: kolonisierte Feuchtgebiete.

Doch wer dem Wasser Land abringt, läuft Gefahr, dass die Natur zurückschlägt. 1953 starben 1.836 Menschen in der größten Flutkatastrophe des Landes. 2100 könnte der Meeresspiegel vor der niederländischen Küste je nach Emissionen um 26 bis 124 Zentimeter gestiegen sein – oder um 2,5 Meter, wenn die Eiskappen schneller schmelzen als gedacht. Die Deltawerke sind auf einen Anstieg von 40 Zentimetern ausgelegt. 26 Prozent des Landes liegen unter dem Meeresspiegel; inklusive Amsterdam, Den Haag, Rotterdam.
Und jetzt zur akuten Katastrophe.
Während der Meeresspiegel steigt, sackt der trockengelegte Polderboden ab. Seit 1.000 Jahren. An manchen Stellen sind dem Land acht Höhenmeter abhandengekommen. Kaum woanders ist das so sichtbar wie in Gouda und Umgebung.
Die Käsestadt liegt 20 Kilometer nördlich von Rotterdam, umgeben von entwässerten Moorwiesen, auf denen Kühe und Böden um die Wette Treibhausgase ausstoßen. Denn: Nachdem der Grundwasserpegel künstlich gesenkt wurde, dringt Sauerstoff in den Torfboden. Bakterien im Erdreich werden aktiv, sie bauen Torfsubstanz ab und setzen CO2 frei. Derweil sackt der Boden in sich zusammen. Ein Teufelskreis, denn so kommt er dem Grundwasser wieder näher. Mit dem Abpumpen wiederholt sich das Absacken. In Städten wie Gouda verhält es sich etwas anders. Um bauen zu können, wurden die Torfböden in den vergangenen Jahrhunderten mit allem Möglichen aufgeschüttet: Nordseesand, Ziegel, Schotter, Holzbalken, Pferdezähne, Pfeifen. Der Torfboden liegt mit sechs Metern so tief, dass er nicht mehr oxidiert, wird aber vom Gewicht der Stadt allmählich zusammengequetscht.
Rund fünf Millimeter sackt die Gegend jedes Jahr ab. Klingt wenig, aber: Manch eine:r wurde nachts schon aus dem Bett geklingelt, weil das eigene Haus einsturzgefährdet war. Lösungen werden am KBF erforscht, dem Wissenszentrum für Bodenabsenkung und Fundamente am historischen Marktplatz in Gouda. Ein schiefes Haus, wie jedes zweite hier, aber deutlich herausgeputzter: mit goldenen Ornamenten und Wappen über der gebogenen Flügeltür und makellosem grauem Anstrich. Nur eine Fahne mit Miniaturschrift verrät, dass die Menschen im Inneren über der Rettung von 425.000 Häusern und etlichen Straßen brüten, in Gouda und überall in den Niederlanden. Wer das Ausmaß begreifen will, heißt es, muss zum Turfmarkt.
Das Pflaster wellt sich
Der kurze Fußmarsch durch die autofreie Innenstadt ist gespickt mit Hinweisen. An vielen Stellen wellt sich die gepflasterte Straße; zwischen manchen Ladengeschäften im Kleiweg müssen sogar zwei Treppen genommen werden, so groß ist der Höhenunterschied. Turfmarkt nennen sich zwei Sträßchen mit Häuserreihen wie Puppenstuben, getrennt durch einen Kanal, über den sich zwei verschnörkelte Brücken schwingen. Seerosenblätter im Wasser, ein hungriger Graureiher lauert auf der Kaimauer. Er muss sich kaum bücken, um den Fisch zu schnappen, so hoch steht der Pegel. Wenn es regnet, läuft das Wasser oft über. Vor einigen Haustüren liegen große Steine: provisorische Stufen, die den Raum zur abgesackten Straße füllen.

Das Problem sind die Fundamente. Unter alten Häusern, Straßen oder Mauern sind sie oft zu niedrig. Sackt der Boden ab, sacken sie mit, Richtung Grundwasser. Hohlräume im Fundament füllen sich und die Feuchtigkeit zieht in den Wänden hoch, in die Wohnräume. Manche Häuser stehen auf Pfählen. Sind diese aus Beton, sind sie sicher, sind sie aus Holz, nicht immer. Damit die Menschen keine nassen Füße bekommen, wie hier am Turfmarkt, muss der Wasserstand gesenkt werden. Allerdings wird dadurch ein Teil der Pfähle freigelegt, das Holz beginnt zu schimmeln. Bis zu 100.000 Euro kann es kosten, das Fundament eines Hauses zu erneuern. Doch in Gouda hat man sich eine günstigere Strategie überlegt. Die Altstadt bekommt einen eigenen Polder; nur in dem eingedeichten Bereich wird der Wasserstand gesenkt. Hier haben viele Häuser niedrige Fundamente und zum Glück nur wenige Holzpfähle.
Allerdings: „In 10, 20 Jahren stehen wir wieder vor dem gleichen Problem“, sagt Gilles Erkens, Experte für Bodenabsenkung und Torfmoore von der Universität Utrecht. Denn das Gewicht der Stadt bleibt. „Wir kaufen uns mit den Wasserstandsregulierungen nur Zeit.“ Zeit, in denen bessere Lösungen erfunden werden oder der Preis für neue Fundamente sinkt. Die andere, langfristige Lösung ist nicht gesellschaftsfähig: Tausende Menschen aus ihren gefährdeten Häusern vertreiben, die Bauten abreißen, den Wasserstand langsam erhöhen. Und weiter: Keine Siedlungen mehr auf weichen Torfböden bauen oder nur schwimmende Viertel.
„Vernünftig wäre, nicht auf Moorgrund zu bauen – wie die meisten anderen Staaten auch“, sagt Erkens. „Wir aber haben so viel davon und einen derart hohen Bevölkerungsdruck, dass es manchmal nicht anders geht.“ Das Gleiche gilt für tiefgelegene Gebiete, wie Westergouwe bei Gouda. Ein Neubaugebiet fünf Meter unter dem Meeresspiegel. „Wenn’s gefährlich wäre, würde hier nicht gebaut“, meinen Bewohner:innen im Dokumentarfilm „De Klimaatverkenner“. Und: „Komt goed“, wird schon. Ein typisches niederländisches Narrativ, das auch an diesem Tag am Turfmarkt in Gouda durchklingt.Eine Passantin um die 35 antwortet, sie mache sich durchaus Gedanken, erst gestern sei der Spoortunnel zwischen Bahnhof und Innenstadt mal wieder überflutet gewesen. Aber: „Mein Haus …
Die Niederlande sind zweifach bedroht: durch den steigenden Meeresspiegel und die Bodenabsenkung. Zur Lösung gehört nicht nur technologischer Fortschritt, sondern kulturelles Umdenken.