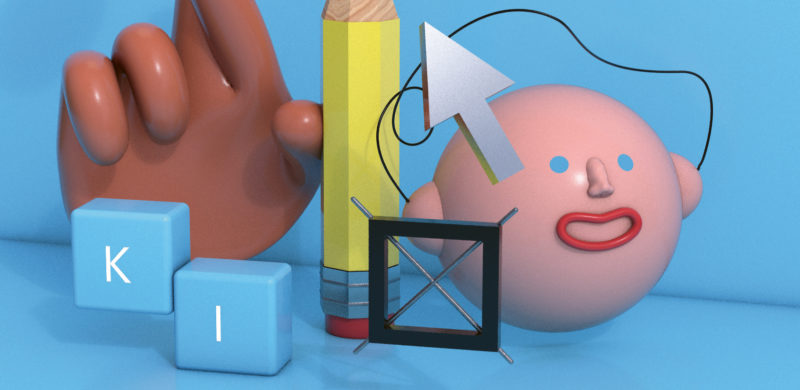Genossenschaften werden oft, und zu Recht, als Vorbilder angesehen, die die Untrennbarkeit von Wirtschaft und Moral eindrucksvoll vorleben. Schon die ersten genossenschaftsnahen Gründungen, eine von Hermann Schulze-Delitzsch initiierte Kranken- und Sterbekasse und der von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründete Brotverein, richteten sich an den direkten Bedürfnissen ihrer Mitmenschen aus. Auch in der Folge hat das konsequente Umsetzen eines kooperativen Wirtschaftens in Genossenschaften, die auf ganz bestimmten Werten und Prinzipien basieren, unzähligen Menschen zu einem besseren Leben in materieller und sittlicher Hinsicht verholfen – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Gerade heute erregt die genossenschaftliche Idee wieder verstärkt Aufmerksamkeit. Angesichts zahlreicher Skandale und Korruptionen in der Wirtschaft sowie politischer und kultureller Unsicherheit sehnen sich viele nach dem Substanziellen, nach Verlässlichkeit und Authentizität. Hier scheinen Genossenschaften in besonderer Weise geeignet, Abhilfe zu schaffen.
Diesem fundamentalen Lob steht eine ebenso fundamentale Kritik gegenüber. Der genossenschaftlichen Idee wird insbesondere vorgeworfen, im besten Fall Sozialromantik zu sein – Werteorientierung im wirtschaftlichen Kontext sei generell unerwünscht. Der Ökonomie-Nobelpreisträger Milton Friedman hat diese Sichtweise wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht, als er erklärte, es sei die (einzige) soziale Verantwortung von Managern, die Gewinne des Unternehmens zu steigern. Unternehmen, die sich darüber hinausgehenden sozialen Zielen verpflichtet fühlten, predigten Sozialismus in Reinkultur. Genossenschaften, die gerade in der Frühphase dem Sozialismus oft durchaus nahestanden, werden auch heute noch häufig mit sozialistischen Idealen assoziiert. Allein die Begriffe „Genosse“ oder „Genossenschaft“ deuten schon eine vermeintliche Verwandtschaft an.
Im Angesicht dieser Ambivalenz im Umgang mit der Genossenschaftsidee scheint eine systematisch-analytische Reflexion der genossenschaftlichen Idee erforderlich. Sie wäre in der Lage, die Bedeutung und das Potenzial der Genossenschaftsidee gerade mit Bezug zur Gegenwart herauszuarbeiten. Genau darin liegt das Ziel dieses Beitrags. Als Ausgangsbasis dieser Analyse ist zunächst eine Betrachtung des vorherrschenden Wirtschaftsparadigmas besonders gut geeignet, um durch Abgrenzung den Kern der genossenschaftlichen Idee zu identifizieren und damit ihre Besonderheiten und ihre Aktualität aufzuzeigen.
Neoklassik als vorherrschendes Paradigma der Ökonomietheorie
Die Neoklassik gehört zum Standardrepertoire in der ökonomischen Lehre und wird oft als Maßstab herangezogen und von vielen Autoren als „ökonomische Mainstream-Theorie“ bezeichnet. Wie Modelle generell bilden auch die Modelle der Neoklassik nicht die reale Welt ab, sondern richten ihren Blick nur auf Ausschnitte der Realität, um Komplexität zu reduzieren. Um dies zu erreichen, wird in den Modellen auf vereinfachende Annahmen zurückgegriffen.
Im Fall der Neoklassik wird in diesem Zuge typischerweise der Homo oeconomicus als vereinheitlichtes Abbild der menschlichen Natur unterstellt – eine Idee, die bis zum antiken griechischen Philosophen Xenophon zurückgeführt werden kann. Im Fokus der Betrachtung steht der egoistisch handelnde und rational entscheidende Akteur, der strikt auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und seinen individuellen Nutzen maximiert. Insbesondere unter – wie sich jedoch durch Analyse der Primärquellen zeigen lässt, grob falscher – Berufung auf Adam Smith argumentieren Ökonom*innen, es sei nicht nur legitim, sondern sogar förderlich, wenn Akteur*innen rein egoistisch handelten. Dies optimiere nicht nur ihren eigenen Vorteil, sondern zugleich den Wohlstand aller.
Welch fundamentale Rolle der Homo oeconomicus für die moderne Ökonomie spielt, wird gerade dann deutlich, wenn man sich die historische Entwicklung der Ökonomietheorie vor Augen führt. Zunächst wurde zu Adam Smiths Zeiten die Ökonomie noch als Bestandteil der Moralp…
Dem Homo cooperativus geht es nicht primär um Profitmaximierung, sondern ein gelingendes Leben.