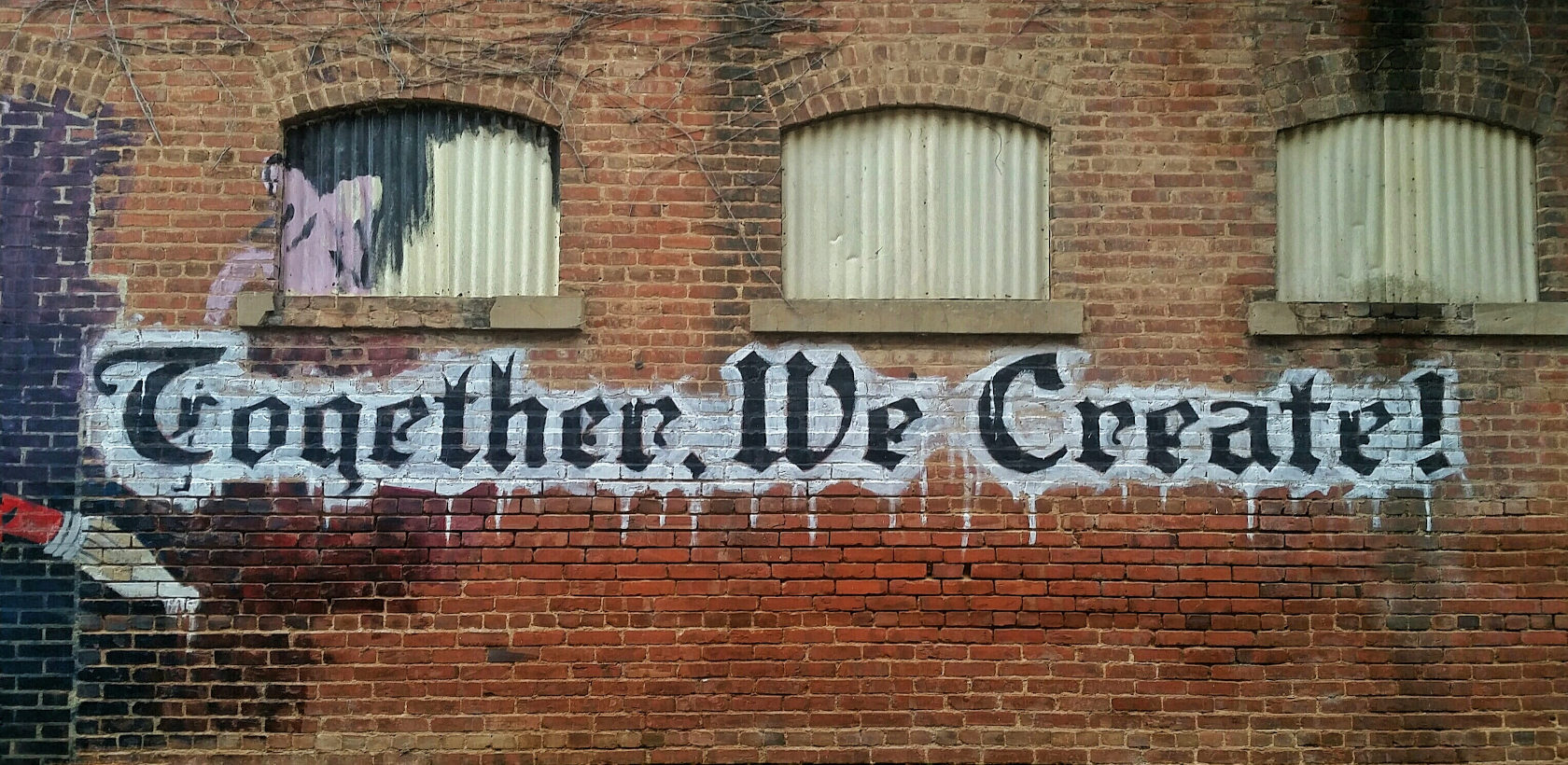Herr Popović, Herr Baumgärtler, Friedrich Wilhelm Raiffeisen wurde vor 200 Jahren geboren. In der Hochphase der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts hat er das ländliche Genossenschaftswesen aufgebaut – eine Alternative zum kapitalistischen Wirtschaften. Was machte Genossenschaften so attraktiv?
Thomas Baumgärtler: Die Gründung der ländlichen Genossenschaften war weniger eine Reaktion auf den Kapitalismus als vielmehr eine Strategie, um etwas gegen die Verarmung weiter Bevölkerungsteile auf dem Land zu tun. Für Bauern war es damals fast ausgeschlossen, Kredite aufzunehmen, um sich etwa Saatgut oder Geräte zu kaufen. Der Wucher blühte, Kreditverleiher verlangten astronomische Zinsen. Wer konnte sich das schon leisten? Raiffeisen wollte daran etwas ändern und den Bauern die Möglichkeit geben, aus eigener Kraft ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern. Für ihn war das eine Frage der Nächstenliebe, die logische Folge seines christlichen Menschenbildes. Schon früh hatte er erkannt, dass Hilfe zur Selbsthilfe ein guter Hebel ist, um die ökonomische Situation der Bevölkerung zu verbessern.
Tobias Popović: Zudem hatte sich die Lage der Bevölkerung durch den gewaltigen Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien zugespitzt, der in Mitteleuropa zu sinkenden Temperaturen und höheren Niederschlägen führte – mit gravierenden Folgen für die Landwirtschaft; vor allem in Süddeutschland verarmte die Bevölkerung. In den Städten schritt zwar die Industrialisierung voran, sich in den kapitalistischen Fabriken zu behaupten wurde für Arbeiter*innen jedoch immer schwieriger. Die Genossenschaften versuchten, auf diese gesellschaftlichen Probleme Antworten zu geben, die allen Mitgliedern der Gruppe dienten.
Schon vor der Industrialisierung gab es Formen gemeinschaftlichen Wirtschaftens, zum Beispiel die Allmende. Haben die Genossenschaften an solche Formen angeknüpft?
Popović: Die Allmende war eher eine Vorform des Sozialismus und hatte große Nachteile. Berüchtigt waren die Mitnahmeeffekte. Allzu oft versuchten Trittbrettfahrer*innen, die Früchte der Allmendewirtschaft zu ernten, obwohl sie nichts dazu beigetragen hatten. Deshalb appellierten Genossenschaften dezidiert an die Eigenverantwortung. Man erkannte, dass gemeinsames Wirtschaften nur funktioniert, wenn jeder solidarisch für sich und die anderen Verantwortung übernimmt.
Wie wurden die ersten Genossenschaften angenommen?
Baumgärtler: Für die Bauern auf dem Land und die kleinen Handwerks- und Handelsbetriebe in den Städten waren Genossenschaften eine Befreiung. Sie bekamen nicht nur bezahlbare Kredite, sie hatten auch erstmals die Möglichkeit, Einkaufs- oder Handwerkskooperationen zu bilden und so ökonomischer zu wirtschaften. Was Raiffeisen für die Landwirtschaft schuf, baute Hermann Schulze-Delitzsch für das Kleingewerbe im urbanen Raum auf. Schließlich war die wirtschaftliche Lage der Kleingewerbetreibenden nicht viel besser als die der Bauern …
Popović: … und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden dann immer mehr Wohnungsbaugenossenschaften als Reaktion auf die Wohnungsnot jener Zeit.
Genossenschaften bewährten sich also als Strategie, um Probleme einer Ära zu lösen?
Baumgärtler: Absolut, das ist eine Kernkompetenz von Genossenschaft. Sie reagiert auf einen Mangel und findet gemeinschaftliche Lösungen. Nicht zufällig haben sich die Formen von Genossenschaft im Laufe der Geschichte geändert. Erst entstanden Kredit-, Einkaufs-, Handels- und Handwerksgenossenschaften, später kamen Wohnungsgenossenschaften. Seit der Weltfinanzkrise sind Kreditgenossenschaften und Genossenschaftsbanken wieder attraktiver geworden, und seit zehn Jahren boomen Energiegenossenschaften. Neuerdings entstehen sogar Pflegegenossenschaften, Schulgenossenschaften und ärztliche Versorgungsgenossenschaften für den ländlichen Raum.
Ökonom Tobias Popović: „Genossenschaften setzen auf Kooperation, auf die Stärke vieler, die etwas gemeinsam voranbringen.“