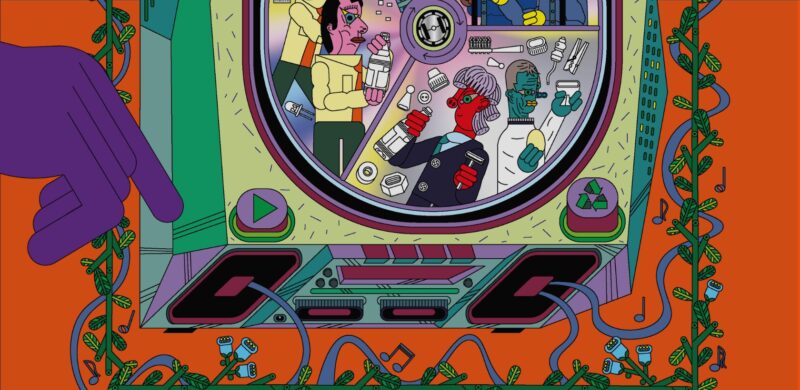Als Angela Verse-Aprile mit zehn Jahren in den „Turnverein von 1861“ einsteigt, hängt noch der Muff alter Zeiten im ehemaligen Männerturnclub des niedersächsischen 30.000-Einwohner:innen-Städtchens Verden. Doch Verse-Aprile liebt das Turnen. Mit fünfzehn schafft sie es zur Trainerin, ein Novum im Verein. Kämpft in den 1980er-Jahren, als die Fitnesswelle durchs Land schwappt, für eine moderne Nutzung der geplanten neuen Vereinshalle, Aerobic, Steptraining, Bauch-Beine-Po-Kurse – Spiegelwand und Musikanlage inklusive. „Wir sind doch keine Disco!“, „Wo bleibt unser Turnsport?“, schimpfen die Alteingesessenen. „Die Welt dreht sich weiter“, entgegnen die Modernisierer:innen. Und gewinnen. Zwei Jahre nach Hallenneubau und Konzeptwechsel hat sich die Mitgliederzahl des Vereins verdoppelt. Das Sich-immer-wieder-neu-Erfinden ist seitdem Teil seiner DNA. Verse-Aprile: „Das macht uns stark.“ Seit 2002 ist sie hauptamtliche Geschäftsführerin des „Turnvereins von 1861“. Mit mehr als 1.000 Mitgliedern ist er heute der größte in der Region.
Das Vereinswesen gehört zu Deutschland wie die Bratwurst und das Schützenfest. Vor knapp 200 Jahren von der Obrigkeit erdacht, um die aufkeimenden Ideen von Freiheit und Gleichheit in unpolitische Bahnen zu lenken, entwickelte sich diese Form des Zusammenschlusses zur urdeutschen Lesart zivilgesellschaftlichen Engagements. Mit dabei war von Anfang an der Sport: Die Turnvereine des Pädagogen Friedrich Ludwig Jahn gehörten zu den ersten Vereinen im 19. Jahrhundert. Zu Tausenden versammelten sich junge Männer zu geselligen, national-patriotischen Leibesübungen. Und heute? Sportverein, das klingt nach dunklen, holzgetäfelten Stuben, Tagesordnung und Kassenwart. Nach rauem Ton, Schweiß und männlichem Machtgerangel. Verstaubt, spießig, überholt. „Seit den 1950er-Jahren wird der Niedergang von Sportvereinen prognostiziert“, sagt Christoph Breuer, Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln. „Doch in Wahrheit sind sie eine erstaunliche Erfolgsgeschichte.“ Biegsam und anpassungsfähig an den Geist der Zeit wie der Turnverein Verden.
Stabile Entwicklung
Die Erfolgsgeschichte belegt schon ein Blick auf die Zahlen: Seit 1982 ist die Anzahl der Sportvereine um fünfzig Prozent gestiegen und in den letzten zwanzig Jahren stabil geblieben. Heute sind etwa 90.000 Sportvereine mit 27 Millionen Mitgliedern im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) organisiert, hinzu kommen Tausende ohne Verbandsanbindung. Laut ZiviZ-Survey (Zivilgesellschaft in Zahlen) des Deutschen Stifterverbands von 2017 ist jeder fünfte Verein der Republik ein Sportverein. Und in keinem anderen Bereich der Zivilgesellschaft engagieren sich die Mitglieder dabei so oft freiwillig für ihren Verein: Jede:r Sechste packt mit an. Es ist längst nicht einfach der Sport, der die Deutschen in Vereine lockt, es ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Erst Auspowern, dann mit Bier oder Smoothie zur Plauderrunde ins Vereinsbistro. Wo Kirchen, Parteien und Gewerkschaften an Bedeutung verlieren, werden Sportvereine „immer wichtiger als Orte der freiwilligen Vergemeinschaftung, an denen sich Menschen aus allen Schichten begegnen und etwas miteinander machen“, resümiert Sportsoziologe Breuer. Das belegen viele Studien, allen voran die Sportentwicklungsberichte, die in Deutschland seit 2004 die Vereinslandschaft unter die Lupe nehmen. Längst steht demnach oft nicht mehr Leistung im Vordergrund, sondern die „Gemeinwohlorientierung“. Sportvereine kümmern sich um Senior:innensport in einer alternden Gesellschaft, wie der Turnverein 1848 Erlangen, der Hochbetagte aus den Dörfern der Region einmal die Woche per Minibus zur Rollator-Gymnastik in der Vereinshalle einsammelt. Oder sie bauen auf Wunsch von Geflüchteten in der Region eine „integrative Sektion Cricket“ auf wie der SG Einhalt Halle. Springen unbürokratisch in Krisen ein wie der Verein „I can do“ aus Hannover, der in der Pandemie Konzepte für Sport auf Abstand entwickelte.
Der Vorteil am Sportverein: „Über den Inhalt Sport erreicht man viele Menschen, unabhängig von Bildung und Herkunft“, sagt Olaf Ebert von der Stiftung Bürger für Bürger in Halle. „Die Form Verein liefert einen nützlichen organisatorischen Rahmen: Er sichert die Träger juristisch ab, verschafft Zugang zu staatlichen Fördermitteln, öffentlichen Sportanlagen und über die Sportverbände das Recht auf die Teilnahme am bundesweiten Wettkampfsport.“ Und ein Verein ist leicht zu gründen: ein Vorstand, eine Satzung, sieben Personen und die Anmeldung im Vereinsregister – fertig. „Damit Sportvereine dauerhaft zukunftsfähig bleiben, müssen sie sich allerdings immer wieder neu erfinden“, so Holger Krimmer, wissenschaftlicher Leiter des ZiviZ-Survey. Denn das Ehrenamt hat sich ebenso verändert wie die Erwartungen der Mitglieder. Kassenwart? Vorstand? „Das wollen nur noch wenige machen“, so Krimmer.
Flexibler Sportmix
65 Prozent der Sportvereine finden nur noch schwer Menschen, die langfristige Fun…
“Das Vereinswesen gehört zu Deutschland wie die Bratwurst und das Schützenfest.”