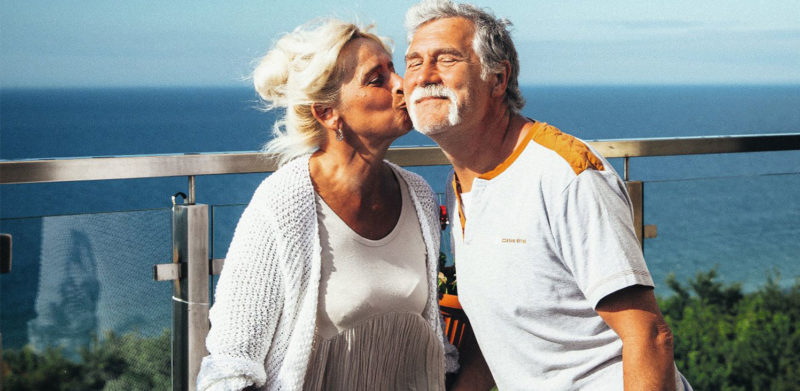*Der Begriff Shoah bezeichnet den Völkermord an Juden und Jüdinnen. Der Begriff Holocaust dagegen bezieht oft auch die Ermordung anderer im Nationalsozialismus verfolgter Gruppen mit ein.
Herr Shohat, der Artikel im Zentrum der Debatte ist der „Katechismus der Deutschen“ des australischen Historikers Dirk Moses. Seine These ist, dass wir uns in Deutschland hinter einer Art pseudoreligiösen Primär-Erinnerungskultur des Holocaust verstecken, um unsere kolonialen Verbrechen nicht aufarbeiten zu müssen. Manche werfen Moses Holocaustrelativierung vor. Was meinen Sie?
Ich teile seine These so nicht. Die deutsche Erinnerungskultur wurde keineswegs „kultartig“ von oben diktiert, sondern es gab eine Bewegung von unten. Vor allem die Geschichtswerkstätten in den 80er-Jahren, in denen Menschen angefangen haben die Nazivergangenheit aufzuarbeiten, waren ein Durchbruch. Zuvor stießen viele Juden und Jüdinnen, etwa der Shoah-Überlebende und Historiker Joseph Wulf, meist auf taube Ohren. Gleichzeitig ist es selbstverständlich richtig, dass es andere Opfergruppen gibt, die unter anderem in der europäischen Kolonialzeit, aber auch in der NS-Zeit schreckliche Gewalt erfahren haben, über die erst seit relativ kurzer Zeit gesprochen wird. Die Shoah und der Kolonialismus stehen wiederum in zeitlicher Kontinuität und in einem räumlichen Verhältnis zueinander. Die Frage des direkten Vergleichs dieser Phänomene ist im deutschen Kontext sehr umstritten, weil natürlich jede Form der Kontextualisierung auch eine Form der Relativierung darstellen kann. In der historischen Genozidforschung ist es jedoch längst Praxis, Dinge aufeinander zu beziehen, nicht um sie gleichzumachen, sondern um sie in ihrer Bedeutung zu schärfen. Wir können ja auch nur sagen, dass die Shoah einzigartig ist, weil das erst im Vergleich zu anderen Genoziden sichtbar wird. Indem wir vergleichen, können wir Spezifika herausarbeiten. Indem wir gleichsetzen, berauben wir Phänomene ihrer Bedeutung.
Gibt es dafür ein konkretes Beispiel?
Der Historiker Jürgen Zimmerer hat etwa vor zehn Jahren einen Sammelband herausgegeben mit dem Titel Von Windhuk nach Auschwitz?. Dort geht es unter anderem um die Konzentrationslager in Namibia, in denen deutsche Kolonialsoldaten Ovaherero und Nama internierten und verhungern ließen. Das Fragezeichen am Ende des Titels ist wichtig, dennoch suggeriert der Titel eine Kausalitätslinie, die es in dieser Form nicht gab. Wir wissen aus der Forschung, dass es zwischen deutschen Kolonialverbrechen und der Shoah gravierende Unterschiede gab. Anders als in der NS-Diktatur gab es in den Kolonien keine Vernichtungslager. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem deutschen und europäischen Kolonialismus und dem Nationalsozialismus, etwa die Existenz von Konzentrations- und Arbeitslagern in beiden Unrechtskontexten. Wir wissen zudem, dass die Rassentheorie und die Abwertung von Minderheiten in der NS-Zeit zum Teil auf Theorien basieren, die ihren Ursprung in der Zeit des europäischen Kolonialismus und der Sklaverei in den USA haben, etwa in der sogenannten „Theorie von der Ungleichheit der Menschenrassen“ von Arthur de Gobineau. Beschreibt man diese Kontinuitäten, nicht Kausalitäten, darf das aber keine Gleichsetzung sein.
Zimmerer plädiert für mehr deutsche Verantwortung, nicht weniger. Auch der jüdische Holocaust-Forscher Michael Rothberg setzt sich für eine „multidirektionale“, also eine pluralistische Erinnerungskultur ein. Wie können wir uns einer solchen Erinnerungskultur annähern?
Indem wir uns der vielfältigen Berührungspunkte bewusst werden. Ich forsche selbst über antikolonialen, panafrikanischen Widerstand gegen den Kolonialismus im Großbritannien der 1930er- und 1940er-Jahre. Dieser Widerstand hat sich immer wieder mit den Juden und Jüdinnen solidarisiert, die im Nationalsozialismus in Europa verfolgt wurden, noch bevor die Verfolgung in der Shoah kulminierte. Die Aktivist:innen waren überzeugt, dass man den Faschismus in Europa nicht glaubwürdig bekämpfen könne, wenn man nicht gleichzeitig den „kolonialen Faschismus“ im Empire bekämpfe. Dem stimmten jüdische Aktivist:innen in Großbritannien zu. Überdies sind dem Vernichtungswahn der Nazis neben den Juden und Jüdinnen auch zum Beispiel Hunderttausende Sinti:ze und Rom:nja zum Opfer gefallen. Da gibt es klar eine rassistische Kontinuität in die heutige Zeit, die dazu führt, dass wir der Verbrechen an ihnen oder an den Ovaherero und Nama nicht so gedenken, wie wir das sollten. Das ist aber ja keine Kritik …
Eine rote Kerze auf einer Stele des Holocaust Mahnmals in Berlin erinnert an die ermordeten Juden und Jüdinnen Europas bei einer Gedenkveranstaltung zum 76. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.