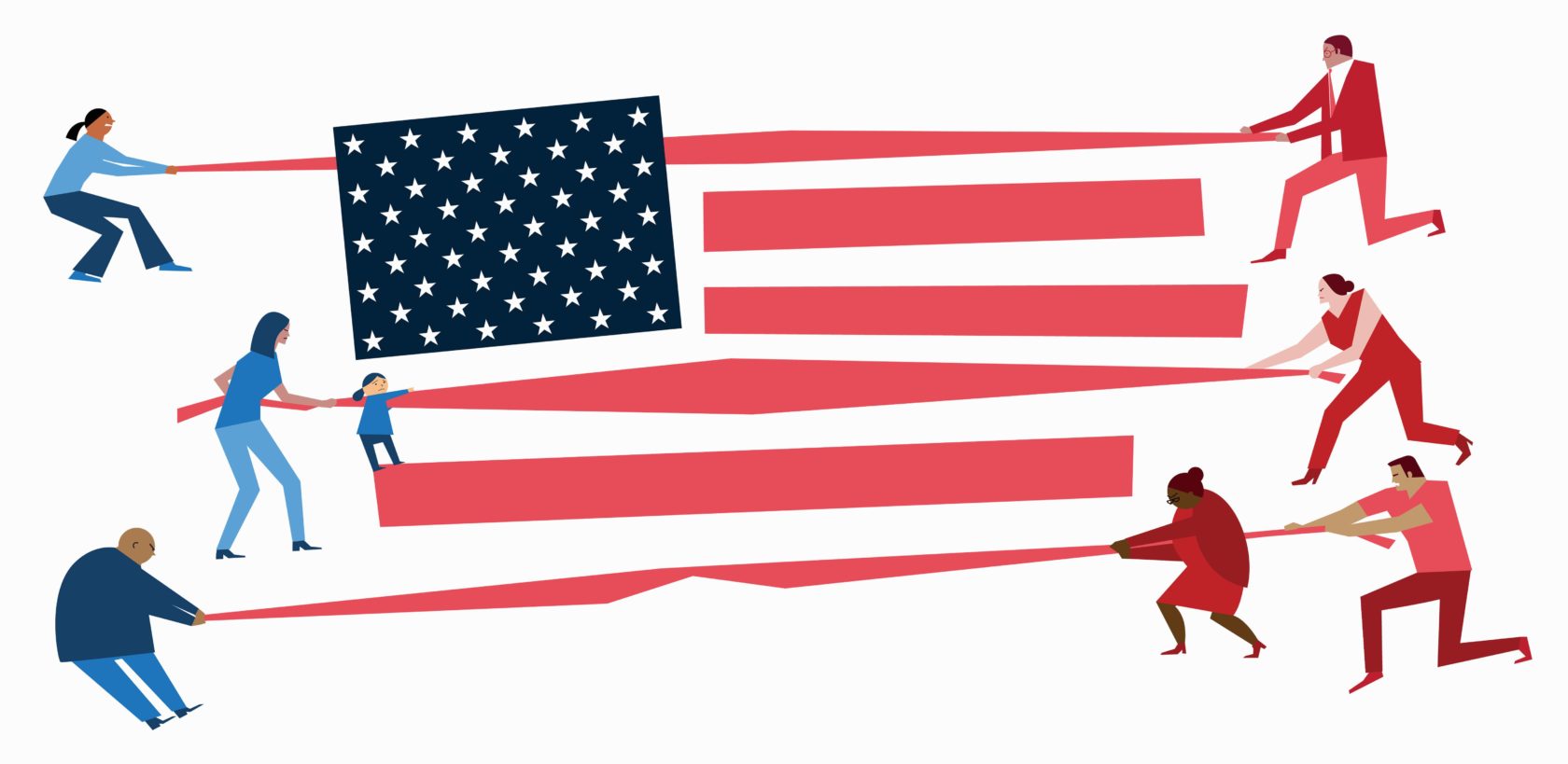Sie sind Sprecher des Vereins Republicans Overseas in Deutschland. Wie engagieren Sie sich bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen?
Da ich nicht in den USA geboren bin, darf ich dort nicht wählen. Die Familie meiner Mutter ist aus den USA. Meine Mutter hatte die doppelte Staatsbürgerschaft. Durch sie bin ich auch zur US Politik gekommen und war seit dem Jahr 2000 zunächst Mitglied bei den Democrats Abroad. Damals habe ich aus Deutschland Al Gore unterstützt. Im Jahr 2004 habe ich dann meinen Jahresurlaub genommen, um in Florida für John Kerry Wahlkampf zu machen. 2008 habe ich in erster Linie für Hillary Clinton Wahlkampf gemacht. Im Herbst desselben Jahres war ich dann in New Hampshire, um die Demokraten zu unterstützen. Doch bei Barack Obama war ich von Anfang an sehr skeptisch. Leider wurden meine negativen Erwartungen noch übertroffen.
Inwiefern?
Ich fand George W. Bush außenpolitisch schon eine Katastrophe, die Obama noch getoppt hat: Obama hat sieben Kriege angefangen.
Welche militärischen Interventionen meinen Sie genau? Und würden Sie tatsächlich davon sprechen, dass Obama in diesen Fällen „Kriege“ begonnen hat?
Ja auf jeden Fall, nämlich in Libyen, Syrien und im Jemen. In Afghanistan hat er ja alles noch mal so richtig verstärkt. Das sind so die Hauptpunkte. Dabei hatte er mit dem Friedensnobelpreis einen großen Vorschuss bekommen und war im Wahlkampf genau mit dem Gegenteil angetreten. Und das zu Recht nach all den Bush-Kriegen. Aber wenn jemand so schnell seine Meinung ändert, da geht für mich sehr viel Vertrauen verloren. Es kann immer eine Sondersituation geben, dass man wo eingreifen muss, aber Obama hat auch Drohnenkriege massiv vorangetrieben und das passt für mich nicht zu dem Friedensgetue aus dem Wahlkampf vorher. Auch Obamas Verhalten Russlands gegenüber war politisch so was von dumm. Die Welt hat sich durch all das destabilisiert.
Viel wichtiger aber war für mich die Wirtschaftspolitik. Als ich 2012 in Wisconsin war, habe ich dort Zustände vorgefunden, da hat es mir die Tränen in die Augen getrieben, bei so viel Armut. So heftig war das zuvor nie, das hat mich zutiefst schockiert. Und Obama hat die Partei innerlich gespalten: Wer irgendetwas kritisiert hat, war gleich rassistisch. Es hieß: Ihr seid weiß und rassistisch. So kann man nicht diskutieren. Das war nicht mehr die Partei, zu der ich mich hingezogen gefühlt habe, mit der ich aufgewachsen bin. Meine Familie waren alle Demokraten. Ich sage immer: Die Partei hat mich verlassen, nicht ich die Partei.
Also sind Sie zu den Republikaner*innen gewechselt?
Ich habe schon 2010 die Demokraten verlassen und bin zu den Republikanern gewechselt. 2012 habe ich dann mit sehr viel Engagement für das Team von Mitt Romney und Paul Ryan in Wisconsin gearbeitet. Ein Höhepunkt war für mich, Paul Ryan in natura zu treffen. Und im Jahr 2016 habe ich dann mit Feuer und Flamme das Trump Team in den Bundesstaaten Colorado, Texas und Pennsylvania unterstützt. Ich hatte die große Ehre den künftigen Präsidenten live in Colorado erleben zu dürfen.
Auch in diesem Jahr engagieren Sie sich, von Deutschland aus, für Donald Trumps Wiederwahl. Sie sind also von seiner Politik weiterhin überzeugt?
Für mich ist Donald Trump der erfolgreichste Präsident seit John F. Kennedy, vor allem seine sehr gute Wirtschafts- und Außenpolitik – er ist der erste Präsident seit 40 Jahren, der keinen neuen Krieg angefangen hat – überzeugt mich zu 100 Prozent. Auch wenn ich an Nordkorea denke, was da erreicht wurde oder dass der IS so massiv geschwächt wurde.
Gerade mit Blick auf den Islamischen Staat kritisieren jedoch viele, auch führende Republikaner*innen, Trumps Außenpolitik im Nahen Osten. Etwa weil er US-Truppen aus Syrien abgezogen hat und damit insbesondere die Kurd*innen im Stich ließ.
Dass so viele das mit den Kurden kritisieren, kann ich nicht verstehen. Trump hatte ja von Anfang an versprochen, dass er sich peu à peu zurückziehen wird aus den ganzen Konflikten. Dafür hat er auch eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Und er hat das nicht von heute auf morgen getan.
In Afghanistan hat der IS jetzt längst nicht mehr diese Power, auch finanziell nicht, weil so viele Konten eingefroren wurden. Auch die Kritik am Rückzug aus Syrien ist keine typische republikanische Grundhaltung, das sagen manche der Falken (Hardliner*innen innerhalb der Partei, die auf militärische Konfliktlösung setzen, Anm. d. Red.), die sich weiter einmischen und das ausbauen würden. Da gibt es einen inneren Flügelkampf. Dass Trump das immer schon anders gesehen hat – er war auch einer der stärksten Kritiker des Irakkriegs damals – das ist für mich ein Grund, dass ich ihn international so stark finde.
Und national vor allem wegen seiner Wirtschaftspolitik? Während der Corona-Pandemie zeichnet sich nun aber ein ganz anderes Bild. Hat die Trump-Regierung in dieser Krise versagt?
Unter Trump hat sich wirtschaftlich viel verbessert, auch für die unteren Einkommen. Unter Corona ist das natürlich jetzt eine andere Situation, das ist klar. Ich finde, insgesamt hat man das Bestmögliche getan. Natürlich sind auch Fehler passiert. Was am Anfang wirklich schlecht lief war, dass zu schleppend mit dem Testen begonnen wurde. Am Anfang haben alle das Virus unterschätzt, aber die USA haben früh reagiert, als weltweit eines der ersten Länder: Sie haben Ende Januar die Grenzen zu China geschlossen. Dafür wurde Trump von Joe Biden als Rassist beschimpft. Wenn Biden damals Präsident gewesen wäre, würden wir über ganz andere Todeszahlen reden.
Sie halten also wenig von einem möglichen Präsidenten Joe Biden?
Abgesehen davon, dass Joe Biden zu alt und mit seiner Demenz vor allem zu krank ist.
… es gibt keinerlei Belege für eine Erkrankung Bidens …
Er darf es auch nicht öffentlich zugeben, weil er sonst nicht mehr Präsident werden könnte. Aber ich habe selbst mal in der Altenpflege gearbeitet und erkenne Leute mit Demenz. Ich bin davon überzeugt: Wenn Biden gewinnen würde, wäre er höchstens ein halbes Jahr im Amt. Aber auch abgesehen davon wäre eine Präsidentschaft von Joe Biden mit einer Vizepräsidentin Kamala Harris eine Katastrophe in Sachen Außenpolitik: Sein Falken-Gebaren und seine peinliche Demut gegenüber China sowie seine Wirtschaftsansätze würden alle Erfolge von Trump zunichte machen!
Sie bezeichnen sich auf Twitter als „pro gay rights“, treten also für die Rechte von homosexuellen Menschen ein. Wie nehmen Sie aus dieser Perspektive die Politik von Donald Trump und der republikanischen Partei wahr?
Ich bin nicht nur pro gay rights, sondern ich bin selbst schwul. Mein Mann und ich sind überzeugte Trumpianer und sehen keinen Widerspruch darin: Trump war der erste Präsidentschaftskandidat, der sich auf einem Parteitag an die LGBT Community gewendet und für ihre Gleichstellung Position bezogen hat – Obama war übrigens im Jahr 2008 als Senator noch gegen die Homo-Ehe, das änderte sich erst während seiner Präsidentschaft. Im Jahr 2019 startete Trump seine globale Initiative gegen Diskriminierung von Homosexuellen, die er auch vor der UNO vorstellte. Er hat außerdem mehrere homosexuelle Richter und Botschafter berufen, unter anderem Richard Grenell, der bis vor kurzem amerikanischer Botschafter in Deutschland war. Und seine Voraussetzung für die Einstellung neuer Richter am Supreme Court ist, dass diese die Homoehe nicht anrühren.
Beim Blick auf die 53 Richter*innen der Bundesbezirksgerichte, die Trump während seiner Amtszeit nominiert hat, finden sich jedoch sehr viele – eine Studie der Bürgerrechtsorganisation Lambda Legal spricht sogar von mehr als einem Drittel –, die als LGBTIQ-feindlich gelten.
Die republikanische Partei muss Leute aus der Mitte, von den Libertären, – zu denen ich mich auch zähle – bis hin zu religiösen Rechten ansprechen. Das ist ein Spagat, der sehr schwierig ist. Ich akzeptiere das.
Sie sprechen von Trumps Unterstützung für die LGBTIQ-Community. Das steht jedoch im krassen Widerspruch zu seiner transfeindlichen Politik, etwa dem weitgehenden Verbot von Transmenschen im Militär. Was sagen Sie dazu?
Ich finde das sehr gut. Da stimmt einfach das Verhältnis der Debatte nicht. Es gibt kaum Soldaten, die trans sind. Die haben ganz andere Sorgen, als ins Militär zu wollen. Wenn das so wäre, müsste sich eine große Mehrheit einer Minderheit unterwerfen. Das ist nicht nachvollziehbar. Das ist auch ein logistisches und finanzielles Thema: Sie müssten in Kasernen alles umbauen lassen, Toiletten für das dritte Geschlecht. Da stimmt das Verhältnis einfach nicht. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Transsexuelle Menschen müssen akzeptieren, dass es auch Bereiche gibt, die ihnen verschlossen bleiben. Transsexualität ist auch etwas ganz anderes als Homosexualität. Ich finde es nicht glücklich, dass das oft in einen Topf geworfen wird.
Dient die Politik der Trump-Regierung der vergangenen Jahre nicht oft eher dem konservativen Flügel? Dass Adoptionsagenturen aus religiösen Gründen etwa schwulen und lesbischen Paaren die Adoption verwehren sollen dürfen?
Anscheinend ist da die amerikanische Gesellschaft noch nicht so weit. In vielen Bundesstaaten ist das ja gar kein Problem, aber in manchen wie zum Beispiel in Kansas ist es eben doch eins, diese Einstellung wird da mit großer Mehrheit getragen. Das muss man akzeptieren, auch wenn man es nicht teilt. Wenn ich in so einem Bundesstaat leben würde, wäre das ein Grund für mich den Wohnort zu wechseln. Weil ich mich da eingeschnitten fühlen würde. Die Bundesregierung kann das auch gar nicht vorschreiben, das ist Ländersache. Und das wäre auch nicht gut, wenn das von Washington aufgezwungen wäre, das ist ja ein riesiges Thema in den USA, dass Washington D.C. zu viel Einfluss hat. Der Unmut darüber wäre kontraproduktiv.
Wie halten Sie davon, dass auf dem Parteitag der Republikaner konservative und evangelikale LGBTIQ-feindliche Redner*innen sprechen durften?
Das ist wichtig, weil sie ein Drittel der Basis abbilden. Es gibt gerade in Swing States wie Michigan und Iowa viele Evangelikale. Die braucht man ja auch. Man kann die jetzt nicht völlig verprellen, man muss auch diese Gruppe mobilisieren. Und der Parteitag soll auch die gesamte Partei darstellen.
Wie stehen Sie zu den teils unwahren Aussagen, die prominent und unwidersprochen auf dem Parteitag geäußert wurden? Etwa dass Parteichefin Ronna McDaniel behauptete, Demokrat*innen wollen Abtreibungen bis zur Geburt erlauben.
Das stimmt aber doch! In Virginia gab es einen Gesetzesentwurf der Demokraten, wonach man bis zum Tag der Geburt legal abtreiben hätte dürfen. In New York geht das auch bis zu einer Woche vor der Geburt.
Solche späten Abtreibungen sind aber jedoch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa wenn die Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben der Mutter darstellen würde. So steht es in dem New Yorker Gesetz und auch in dem Gesetzentwurf in Virginia, der jedoch nicht verabschiedet wurde. Etliche republikanisch regierte Staaten haben hingegen die Gesetzgebungen zu Schwangerschaftsabbrüchen massiv verschärft. Sind Sie für ein Abtreibungsverbot?
Da bin ich überhaupt nicht dafür. Ich finde das völlig legitim, dass man in den ersten zwei Monaten abtreiben darf. Aber ich finde es halt ab dem Moment schwierig, wenn man ein Herz schlagen sieht. Da hat sich meine Meinung geändert. Früher war ich auch auf der ganz linken Seite, was das Thema anging. Die Meinung der ganz religiösen Rechten in der Partei, die Abtreibung vom ersten Tag an als Mord bezeichnen, finde ich aber auch völligen Quatsch.
Wie fanden Sie die anderen Reden auf dem Parteitag?
Ich fand die Rede von Donald Trumps Sohn (Donald Trump Jr., Anm. d. Red.) sehr gut, weil es da um die freie Schulwahl ging. Dass man nicht nur wegen seiner Postleitzahl verdonnert ist, auf eine vielleicht schlechtere Schule zu gehen. Das finde ich schon sehr gut. Und Nikki Haley fand ich auch wieder sehr gut.
Nikki Haley – ehemalige Gouverneurin South Carolinas, deren Eltern aus Indien in die USA eingewandert sind – hat in Ihrer Rede auch gesagt, die USA seien kein rassistisches Land. Stimmen Sie dem zu, dass es kein Rassismus-Problem in den USA gibt?
Natürlich gibt es ein Rassismus-Problem, keine Frage. Den Teil ihrer Rede fand ich auch nicht so gelungen. Aber es gibt nur in bestimmten Bundesstaaten ein Problem. In Minnesota, Wisconsin oder in Washington, wo es gerade viele Proteste gibt, das sind Staaten, wo es kein strukturelles Rassismus-Problem gibt. Ich könnte es verstehen, wenn die Proteste in Louisiana wären. Da könnte ich nachvollziehen, woher das kommt.
Um vor den US-Wahlen verschiedene Perspektiven zu zeigen, kommen hier sowohl Unterstützer*innen der demokratischen als auch der republikanischen Partei zu Wort.