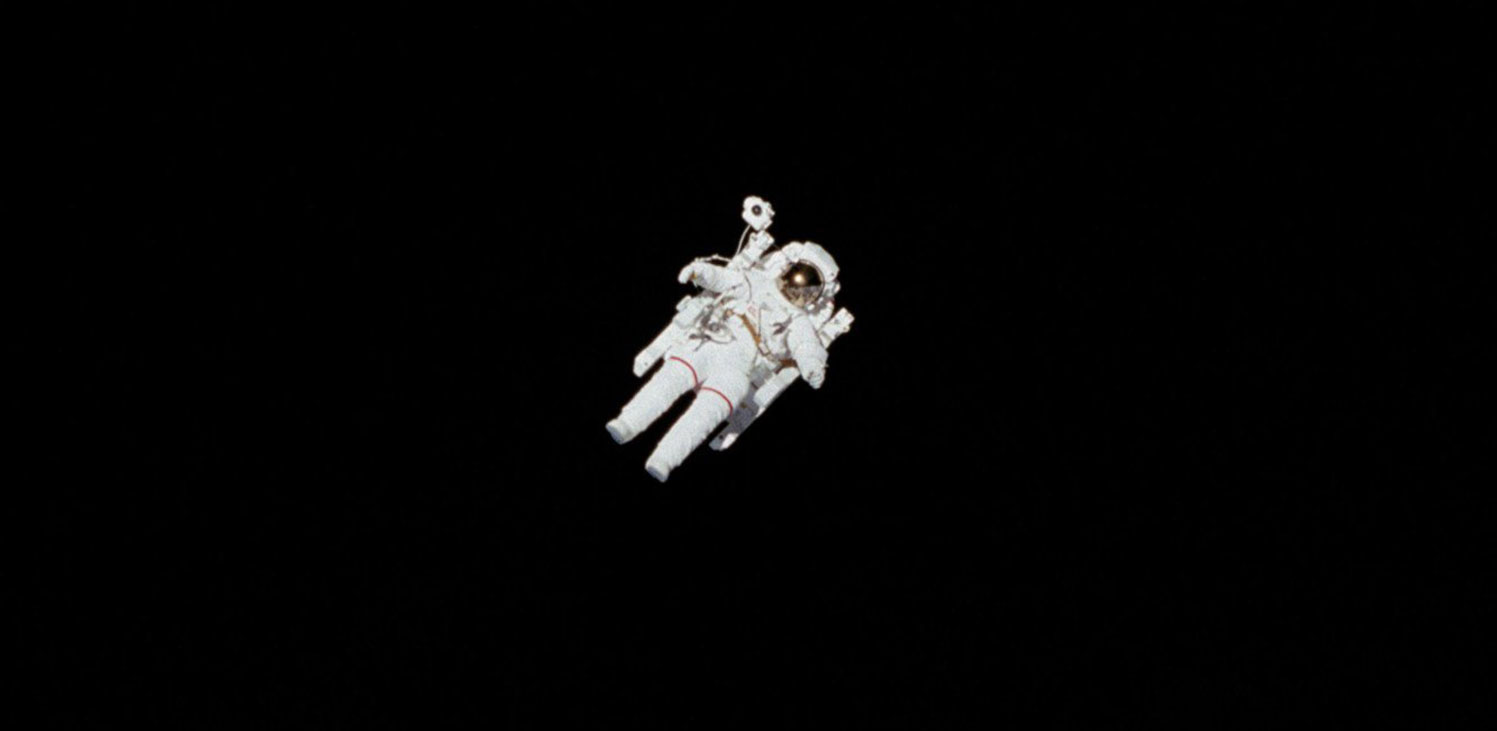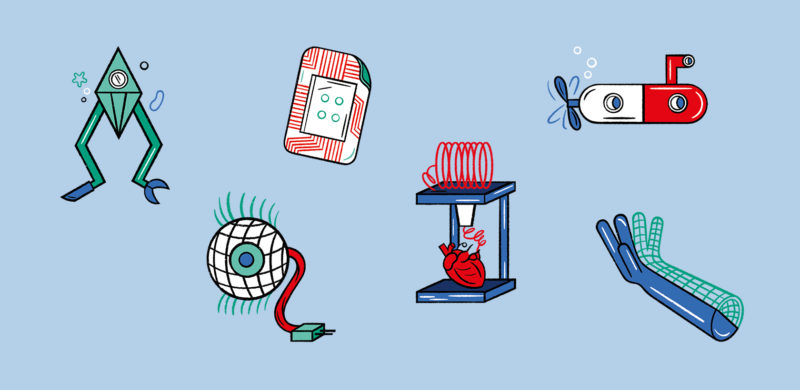Seit dem Frühjahr 2017 haben wir ein neues Licht und sein Name ist Steve. Steve ist eine Himmelserscheinung, die man mal mit einem Nordlicht, mal mit Kondensstreifen von Flugzeugen verwechseln kann. Vollständig erforscht ist das Phänomen noch nicht, offensichtlich handelt es sich aber um ionisiertes Gas, so heiß wie der Erdkern, das sich mit über 23.000 Kilometern pro Stunde in einer Wolke fortbewegt.
Interessant an Steve ist aber vor allem die Geschichte von dessen Entdeckung: Kein Team aus dutzenden Nasa-Forschern, keine milliardenteuren Messgeräte – sondern begeisterte Fotografen in einer Facebook-Gruppe hat Steve entdeckt und ihm auch seinen Namen gegeben, wie die New York Times berichtet.
Die Fotografen waren eigentlich auf der Jagd nach spektakulären Aufnahmen von Nordlichtern in Kanada. Statt Aurora Borealis fanden sie eben Steve, das sie zunächst für eine Protonenlichtquelle hielten. Sie machten berufsmäßige Astronomen und Physiker darauf aufmerksam, die die Entdeckung ins richtige Licht rückten.
Die Geschichte von Steve ist nur eine der jüngeren in der sogenannten Citizen Science. Grob aus dem Englischen übersetzt handelt es sich dabei um Bürgerwissenschaft. Otto Normalverbraucher hilft also dem Forscher mit Kittel und Mikroskop bei dessen Arbeit. In den letzten Jahren etablieren sich immer mehr Projekte und Initiativen, die unter Citizen Science laufen. Zufällige Kooperationen und Entdeckungen wie die von Steve sind dabei sogar eher die Ausnahme. Meist ist diese Zusammenarbeit zwischen Laien und Experten ausdrücklich gewollt. Und wieder einmal müssen wir festhalten: Schuld ist das Internet.
Internet: Perfekte Basis für Citizen Science
Dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine ist ein Trend, den man mit „Demokratisierung der Wissenschaft“ überschreiben könnte. Selbst dort, wo wir von Entwicklungsländern sprechen, haben immer mehr Menschen Zugang zum gesammelten Wissen der Menschheit, jederzeit in ihrer Hosentasche. Die Wissenschaft ist transparenter geworden, dadurch leichter zugänglich. Der Austausch mit fachfremden Laien über das Internet und Social Media gehört für moderne Forscher zum Standardrepertoire.
Stichwort soziale Medien: Was Citizen Science in den letzten Jahren ebenso befeuert hat, ist das immense Vernetzungspotenzial des Internets. Innerhalb von Stunden und mit nur wenigen Klicks kann man praktisch Millionen an Menschen erreichen. Ein dritter Faktor sind komplett neue Formen der Darstellung, Aufbereitung und Interaktivität.
Daher überrascht es nicht, dass sich die meisten modernen Citizen-Science-Projekte mehr oder minder im digitalen Raum abspielen – wortwörtlich. Denn nicht wenige machen sich den natürlichen Spieltrieb des Menschen zunutze, indem sie ihre Wissenschaft in Computerspiele verpacken. Dabei gibt es Games, die dezidiert einem akademischen Zweck dienen. Bei „Sea Hero Quest“ macht man nicht viel mehr als ein Boot navigieren, sich Karten einprägen, Fabelwesen fotografieren und Leuchtraketen abschießen.
Gleichzeitig hilft man aber britischen Forschern, Demenz besser zu verstehen, da die Spieldaten Aufschluss darüber geben, wie Menschen sich räumlich orientieren. Die University of Was…
Man muss kein Astronaut sein, um bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse voranzutreiben. Mit Citizen Science kann jeder zum Forscher werden