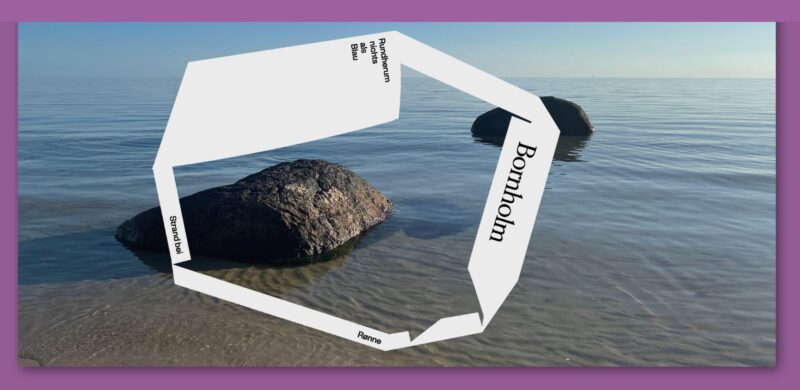Bis in die Morgenstunden hat es geregnet. Weißer Nebel steigt aus dem Wald auf, kaum auseinanderzuhalten von den tiefen Wolken. Feuchte und kühle Luft zieht in die Lehmhütte, die zur Straße hin offen ist. Die Vertreter:innen des Dorfes Barumbi, die dort versammelt sind, haben sich Pollunder, Jeansjacken und Westen übergeworfen.
An Regentagen weicht der Waldboden hier im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo im Nu auf. Klitschnass wird, wer sich durch das blätterreiche Dickicht wagt. Heute bleiben die Dorfbewohner:innen deshalb daheim. Sonst ziehen sie schon früh in den Wald, erzählt Jacques Mangala. Erste graue Haare wachsen am Kinn des Fünfzigjährigen, der mit geübter, sicherer Stimme für die Dorfbewohnenden spricht. „Für den Alltag unserer Gemeinde spielt der Wald eine enorm wichtige Rolle.“ Sie jagen, fischen, sammeln Feuerholz, pflanzen Maniok und finden heilende Kräuter. Manches verkaufen sie. „Alles, was wir essen, ja selbst die Mittel für die Schulgebühren unserer Kinder kommen aus dem Wald.“
Früher hielten Regentage wenigstens die Eindringlinge fern, die sonst so oft in ihren Wald kamen. „Sie schlugen Holz, gruben Minen, töteten Tiere, auch solche, die unter Artenschutz stehen“, sagt Mangala. Formal hatten sie sogar oft Genehmigungen, ausgestellt von staatlichen Behörden. Manchmal kassierten auch einzelne Mitglieder der Gemeinde ab und ließen sie in den Wald, erzählt Mangala: „Das Geld steckten sie in die eigene Tasche. Die Gemeinde hatte nichts davon.“
Die Last des kolonialen Erbes
Nun jedoch haben die Bewohner:innen von Barumbi den Titel „Waldbewirtschaftungskonzession für lokale Gemeinden“, den der Staat seit gut sieben Jahren vergibt. Die Hoffnung: Wenn sich die lokalen Gemeinden, die schon seit Generationen im Wald leben, selbst um den Wald kümmern, lässt er sich langfristig besser bewahren. Wer daher heute Barumbis Regenwald wirtschaftlich nutzen will, braucht die Genehmigung der Gemeinde mit ihren etwa 300 Einwohner:innen. Sie ist in einem Komitee organisiert, dem Mangala vorsitzt. „Wir wollten den Titel, um unseren Wald zu schützen“, sagt er.
Es ist ein Paradigmenwechsel, der sich hier in Barumbi vollzieht. Denn auf der Demokratischen Republik Kongo lastet das koloniale Erbe. Schon der belgische König Leopold der Zweite wollte den zweitgrößten Regenwald der Welt ausbeuten, durch den sich der mehr als 4.000 Kilometer lange Kongo-Fluss zieht. Das Gebiet, das er auf der Berlin-Konferenz im Jahr 1885 für sich beanspruchte, ist heute eines von sechs Ländern des Kongo-Beckens, wenn auch mit fast zwei Dritteln der Fläche das größte Areal des zentralafrikanischen Regenwaldes. Die belgische Kolonialmacht erklärte die Wälder zu staatlichem Eigentum und vergab Konzessionen für Plantagen und Holzschlag.
Arme Provinz voller Schätze
Nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1960 änderte sich an der Staatsräson wenig: Genehmigungen werden bis heute in der Hauptstadt, in den Provinzen oder in der Lokalverwaltung eingeholt, je nach Umfang des Vorhabens. Zwar haben die lokalen Gemeinden ein Anrecht auf formale Mitsprache sowie auf finanzielle oder soziale Zuwendungen. In der Realität kommt jedoch kaum etwas bei ihnen an. Das beklagen auch die Einwohner:innen der Provinz Tshopo, in der sich Mangalas Gemeinschaftswald befindet. Die Provinz ist arm, trotz des Reichtums an natürlichen Ressourcen: Wälder, Gold, fruchtbare Felder. Dem nationalen Ernährungsprogramm zufolge sind 43 Prozent der Kinder unter fünf Jahren unterernährt.

Die „gemeinschaftliche Waldbewirtschaftung“ könnte Grundsätzliches ändern. Sie basiert auf einer Reform aus dem Jahr 2014. Seitdem kann der Staat Gemeinschaftswälder schaffen, indem er sogenannte Waldkonzessionen an lokale Gemeinden vergibt. Die Bewohnenden bekommen die Hoheit über den Wald. Wer nicht mit ihnen direkt verhandelt, hat im Wald nichts zu suchen. Immer mehr Gemeinden kämpfen darum, diese Rechte zu bekommen, meist mit der Unterstützung von Umweltorganisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Es ist ein ambitioniertes Konzept, das die Machtverhältnisse im kongolesischen Wald umkrempelt. Die Gemeinden müssen intensiv begleitet und weitergebildet werden, damit sie ihre neue Rolle ausfüllen können: Hüter:innen des Waldes.
Barumbi liegt an der Nationalstraße 4. Die Schotterpiste führt aus der Provinzhauptstadt Kisangani von Tshopo in Richtung Uganda, wo das Regenwaldgebiet ausläuft. Jacques Mangala ist zu Fuß unterwegs, trabt an ein paar Hütten vorbei, folgt der Straße noch ein paar hundert Meter und schlägt dann links ins Dickicht des Waldes ein. Schon bald lichtet dieser sich etwas. Zwischen den Baumstämmen reihen sich Kakaosträucher. „Expert:innen haben uns erklärt, dass wir ihnen etwas Licht geben müssen. Das erleichtert das Wachstum der Pflanzen.“ Ein paar der Bäume mussten sie dafür fällen – aber im Gegensatz zu einer Plantage bleibt das Ökosystem des Regenwaldes weitgehend intakt.
Unterstützung hat Mangala von Tropenbos bekommen, einer niederländischen Nichtregierungsorganisation mit kongolesischwem Ableger in Kisangani. Mit Tropenbos hat er den Titel für sein Dorf erstritten. Jetzt schult die NGO die Gemeinde darin, wie sich die Wälder wirtschaftlich nachhaltig nutzen lassen. Auf einer Fläche von 30 mal 40 Metern wachsen seitdem die Kakaosträucher. „Wir warten nun auf die Vermarktung“, sagt Mangala. Der Anbau soll der Gemeinde neue Einnahmen bringen.
Kahle Löcher im Wald
Auf den ersten Blick ist das Kongo-Becken nicht so stark von Rodungen bedroht wie der Amazonas-Regenwald. Dort werden ganze Landstriche kahl rasiert, um Soja anzupflanzen und Rinderherden zu weiden. Hier dagegen, entlang der Nationalstraße, sind viele kleinflächige Löcher im Wald versprengt. Oft liegen sie um die Dörfer herum. Auf den kahlen Stellen: Reisfelder und Palmölplantagen. Eine Holzfirma hat Straßen in den Wald geschlagen, um Tropenstämme für den Export herauszuschaffen.
Im Kongo geht im Jahr eine halbe Million Hektar Wald verloren, so viel wie zweimal das Saarland. Das Tempo der Entwaldung ist auf die Fläche umgerechnet genauso schnell wie in Brasilien. Der Hauptreiber ist jedoch die kleinflächige Rodung, insbesondere der „Wanderfeldbau“: Bewohner:innen von Dörfern nahe des Regenwaldes holzen ein kleines Stück Wald ab, verbrennen das Unterholz, pflanzen Maniok und Mais, bis der Boden erschöpft ist – und nehmen sich dann ein neues Areal vor. Der Wald wächst von alleine nach. An sich ein nachhaltiges Konzept, das jahrhundertelang funktionierte. Doch seit die Bevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo stark wächst, kommt das Konzept an Grenzen. Heute leben 100 Millionen Menschen im Land, 215 Millionen werden es voraussichtlich 2050 sein, sagt das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen voraus. Auch deshalb fressen sich die Felder immer tiefer in die Wälder hinein.
Ein paar Kilometer hinter Barumbi beginnt der Gemeinschaftswald einer Nachbargemeinde. Sie heißt Bapondi. Philémon Liombo, ein kongolesischer Fachmann von der Organisation Tropenbos, betreut sie. Er ist mit dem Motorrad gut 138 Kilometer aus der Provinzhauptstadt angereist und steht nun mit gelben Gummistiefeln im Wald. Die lokalen Gemeinden haben ein Interesse, ihren Wald zu schützen, brauchen dafür aber neue Expertise, sagt er: „Wir zeigen ihnen, wie sie den Wald klug und nachhaltig bewirtschaften können.“ Er aktiviert das GPS-Gerät und läuft so gerade wie möglich durch den Wald, bahnt sich durch dickes Geäst, springt über einen umgestürzten Baum. Drei Mal schlägt er nach rechts ein, bis er ein Rechteck gelaufen ist. 422 Meter zeigt das Gerät an, als er am Ursprungspunkt ankommt. Der Umfang der Fläche, auf der sie auch hier einmal Kakaofrüchte ernten wollen. Er braucht die Koordinaten für eine präzise Kartografie des Waldes. Sie legt genau fest, wo was geschehen soll: Jagd, Ackerbau und Holz…
Valentine Natikotiko, Vorsitzende des Gemeinschaftswaldes in der Gemeinde Bapondi.