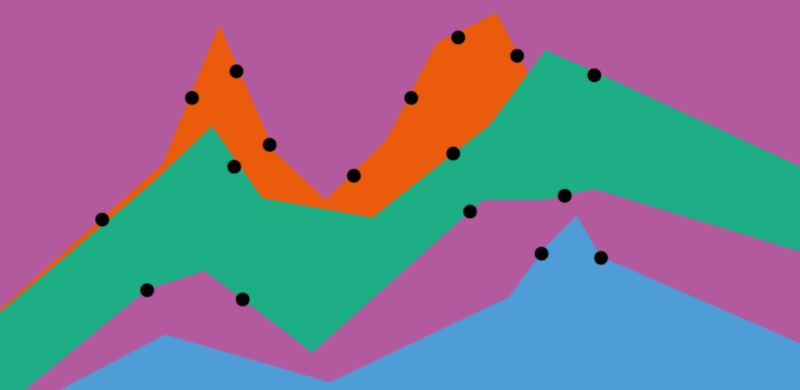Scheitert die deutsche feministische Außenpolitik gerade am Umgang mit dem Iran?
Rachel Tausendfreund: Nur weil Deutschland diesen Begriff übernommen hat, kann es nicht gleich eine feministische Welt zaubern. Es ist unfair zu verlangen, dass jedes Land, das feministische Außenpolitik machen will, sofort alle Probleme für Frauen und andere marginalisierte Gruppen lösen muss. Deutschland setzt sich im Iran ein, unterstützt die Protestierenden laut und deutlich und verurteilt die Gewalt des Regimes. Was noch fehlt: mehr Visa für gefährdete iranische Aktivist:innen. Und wir sollten sowohl die feministische Diaspora als auch zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort fragen: Was können wir tun? Dennoch: Das, was passiert, ist realistische feministische Außenpolitik. Leider, denn die Einflussmöglichkeiten Deutschlands und Europas sind begrenzt.
Miriam Mona Mukalazi: Das stimmt. Es ist nicht realistisch, über Nacht eine feministische Außenpolitik zu etablieren. Sie trägt jedoch dazu bei, den Sicherheitsbegriff neu zu definieren. Der Konflikt im Iran ist zwar gerade sehr prominent, aber nicht die einzige Krise, mit der Deutschland sich beschäftigen sollte. Was ist etwa mit dem Jemen oder der Demokratischen Republik Kongo? Feministische Außenpolitik kann bei diesen Konflikten Denkanstöße geben: Gibt es Lösungen, über die wir vorher noch nicht nachgedacht haben?
Was heißt das konkret?
Mukalazi: Ich verstehe Feminismus, also auch feministische Außenpolitik, als eine Form von Machtkritik und Widerstandspraxis. Sie richtet sich nicht nur gegen Machtgefälle zwischen Staaten und Geschlechtern, sondern auch gegen andere Unterdrückungsformen wie Rassismus. Sicherheit schaffen bedeutet, die Menschenrechte derjenigen zu schützen, die am meisten unter struktureller Gewalt leiden. Es geht keineswegs nur um Frauen, sondern genauso um queere, nicht-weiße oder behinderte Menschen. So eine feministische deutsche Außenpolitik ist für mich aktuell eine Utopie.
Tausendfreund: Ich sehe das pragmatischer. Das Kernziel ist Gleichberechtigung, also gleiche Rechte sowie Teilhabe – politisch, ökonomisch oder sozial – für alle, unabhängig von Geschlecht oder anderen Diskriminierungsformen. Das hat Deutschland auch im eigenen Land noch nicht verwirklicht. Das muss sich ändern, damit die Außenpolitik nicht unglaubwürdig wird.
Im Koalitionsvertrag steht das Bekenntnis zu einer feministischen Außenpolitik. Die Regierung möchte „Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken“, sowie „gesellschaftliche Diversität fördern“. Für das Frühjahr erarbeitet das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock Leitlinien (Anm. d. Red.: Die Leitlinien wurden nach diesem Gespräch, am 1. März 2023, hier veröffentlicht). Ist das glaubwürdig?
Tausendfreund: Ich werde weniger enttäuscht sein von den Leitlinien als andere in der feministischen Community. Immerhin dürfte es Strategien für mehr Diversität und Gleichstellung im Auswärtigen Amt geben und mehr finanzielle Ressourcen für die feministische Zivilgesellschaft. Wenn dazu ein verlässliches Monitoring kommt, ist das ein großer Fortschritt. Sowieso ist unsere Außenpolitik schon lange viel feministischer, als oft kritisiert. Wir haben längst keine Politik wie in den 1920ern mehr, wo es darum ging, alles mit Waffengewalt zu erreichen. Jetzt sind auch die Sicherheit der Menschen vor Ort und Klimagerechtigkeit zentral.
Mukalazi: Nur weil wir Baerbock als starke feministische Außenministerin haben, bedeutet das nicht, dass ihr Habeck oder Scholz folgen. Deutschland arbeitet ja schon seit Jahrzehnten an einer feministischen Außenpolitik, zumindest was internationale Vereinbarungen angeht. Etwa die UN-Resolution 1325, die sexuelle Gewalt in Kriegen ächtet und mehr Frauen in Verhandlungen fordert. Die neuen Leitlinien müssen daran anschließen, sonst bleiben sie ein persönliches Projekt von Baerbock – und könnten verschwinden, sobald sie nicht mehr im Amt ist. In Schweden ist genau das mit einer neuen Regierung passiert. Es geht also um eine nachhaltige Veränderung in der Außenpolitik Deutschlands und nicht einfach darum, dass mehr Frauen mitmischen.
Leitlinien für feministische Außen- und Entwicklungspolitik
Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) haben am 1. März 2023 Leitlinien für mehr feministische Politik in ihren jeweiligen Ministerien vorgestellt. Die Leitlinien für das Auswärtige Amt (hier findest du das Dokument) sehen unter anderem eine Botschafterin für feministische Außenpolitik vor, die vor allem nach innen wirken soll. Zudem sollen mindestens 50 Prozent der Führungspositionen im Ministerium mit Frauen besetzt werden. Bis 2025 sollen gemäß den Leitlinien für eine feministische Entwicklungspolitik (hier findest du das Dokument) 93 Prozent neu zugesagter Projektmittel in Vorhaben fließen, die Gleichstellung voranbringen.Schweden hat 2014 als erstes Land eine feministische Außenpolitik eingeführt. Was lässt sich davon lernen?
Tausendfreund: Deutschland übernimmt die etablierten Prinzipien Schwedens, ergänzt sie aber um Diversität. Das sollte auch die Einstellungs- und Beförderungspolitik des Auswärtigen Amts verändern und kann anderen Ministerien Druck machen nachzuziehen. Was Schweden angeht, erwarte ich übrigens keine deutlich andere Außenpolitik, nur weil von Feminismus offiziell nicht mehr die Rede ist. Im dortigen Außenministerium arbeiten, anders als in Deutschland, schon fast genauso viele Frauen wie Männer, auch auf höchsten Ebenen. Das wird sich nicht so schnell ändern.

Miriam Mona Mukalazi
promoviert über feministische Sicherheitspolitik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Philipps-Universität Marburg. Zuvor arbeitete sie für UN Women Deutschland. Foto: Kyna Uwaeme
Rachel Tausendfreund
ist Redaktionsleiterin der unabhängigen US-amerikanischen Stiftung German Marshall Fund und stellvertretende Vorsitzende des Vereins Women in International Security Deutschland. Foto: Juliette MoarbesStudien wie vom International Peace Institute aus dem Jahr 2015 zeigen: Frauen an Friedensverhandlungen zu beteiligen, macht es um 35 Prozent wahrscheinlicher, dass ein Friedensabkommen mindestens 15 Jahre hält. Ist es so einfach oder braucht es mehr?
Mukalazi: Wenn mehr Frauen dabei sind, stärkt es Verhandlungen und macht sie inklusiver. Aber es wäre falsch, daraus abzuleiten, dass Frauen per se friedlicher sind. Und Frauen denken auch nicht automatisch an die Interessen aller anderen Gruppen. Daher müsste Außen- und Sicherheitspolitik grundsätzlich mehr Lebensrealitäten abbilden, etwa verschiedene Ethnien oder Religionen. Je diverser die Gruppe, umso diverser die Resultate. Das Problem: Meist bleibt die Verantwortung an den Ausgeschlossenen selbst hängen. Frauen sollen die Außenpolitik feministischer machen, Menschen mit Migrationsgeschichte sollen sie postkolonialer gestalten. Dabei muss eine diversere Politik ein gemeinsames Projekt sein. Initiativen wie „Diplomats of Color“ vom Auswärtigen Amt selbst oder „Vielfalt im Amt“ von der Deutschlandstiftung Integration könnten solch ein Umdenken einleiten.
Tausendfreund: Oft drohen allerdings feministische, zivilgesellschaftliche Organisationen finanziell zu verhungern. Wie es besser geht, zeigt etwa Kanada: 2018/2019 flossen 92 Prozent der Gelder der Entwicklungszusammenarbeit in genderbezogene Projekte. Außerdem hat Kanada einen länderübergreifenden Fonds initiiert und 2019 umgerechnet gut 200 Millionen Euro in ihn investiert, um die feministische Zivilgesellschaft überall auf der Welt zu unterstützen.
Mit Mexiko und Libyen setzen auch Länder des Globalen Südens auf eine feministische Außenpolitik. Was können wir voneinander lernen?
Tausendfreund: Feminismus ist kein westliches Konzept. In der politischen Repräsentation stehen nicht nur nordeuropäische Länder, sondern auch viele Staaten im Globalen Süden besser da als Deutschland. Ruanda hat ein Parlament mit 61 Prozent Frauenanteil in der Abgeordnetenkammer. In Libyen gibt es schon viel länger eine weibliche Außenministerin. Feministische Außenpolitik bedeutet auch,…
Ist eine deutsche feministische Außenpolitik noch Utopie? Ja, sagt Miriam Mona Mukalazi (links). Nein, sagt Rachel Tausendfreund.