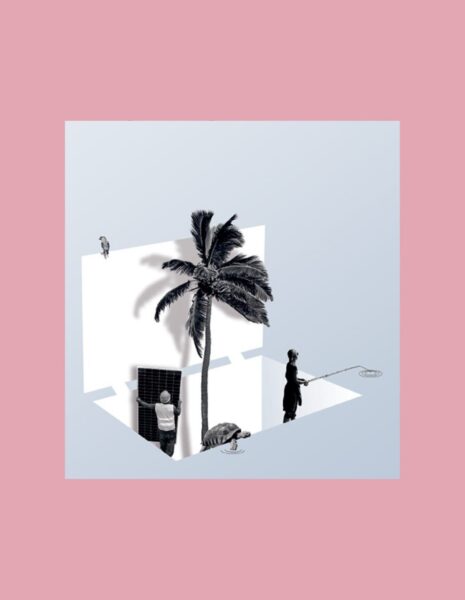Im schwedischen Mälarsee, nordwestlich der Hauptstadt Stockholm, schwimmt Vifärnaholme, eine kleine Insel mit rot-weißem Holzhaus und Privatstrand, die man nur per Boot erreichen kann. Jeder Mensch kann sich darum bewerben, eine Woche lang allein und kostenlos auf Vifärnaholme zu wohnen und zu arbeiten – vorausgesetzt man hat eine kreative Idee, die den Besitzer der Insel, den schwedischen Unternehmer und Autor Frederik Härén, überzeugt.
„Ich wollte, dass mehr Menschen erleben […], wie die kreativen Säfte explodieren, wenn sie vom Rest der Welt isoliert sind und sich einfach auf das Projekt konzentrieren können, das sie realisieren möchten“, schreibt er auf seinem Blog „The Human Island“. Für Härén sind Inseln ein Mikrokosmos unseres Planeten und können uns helfen, uns selbst und andere besser zu verstehen. Und mit dieser Überzeugung ist er nicht allein.
Die Vorstellung einer abgeschiedenen Insel – in einer anderen, abgeschlossenen Welt zu sein, den Blick stets auf den verheißungsvollen Horizont gerichtet, die Möglichkeit eines Neuanfangs – ist eine zeitlose Sehnsucht des Menschen.
Von Inselparadiesen und einsamen Eilanden
Unsere Mythen, Fantasien und Bucket Lists sind voll von Inselparadiesen: Sie heißen Avalon, Elysium und Nimmerland, Mallorca, Sansibar und Hawaii. Eilande voller Abenteuer, Magie und Schönheit, Traum-Reiseziele, Party-Hochburgen. Genauso tummeln sich in unserer Kulturgeschichte aber auch Insel-Albträume: Schon in der Legende von Atlantis, später in Filmen wie King Kong und Jurassic Park, wird der Mensch auf Inseln mit der Überlegenheit der Natur und seiner eigenen Hybris konfrontiert. Du dachtest, du bist die Krone der Schöpfung und kannst alles mit ihr machen, was du willst? Falsch gedacht, lautet die Moral dieser Geschichten.
Auch auf historischen Gefängnisinseln wie Alcatraz oder Robben Island wurde die idyllische Oase zur Falle, aus der es sich nicht so schnell entkommen ließ. Nicht zufällig stammt das Verb „isolieren“ von „insula“, dem lateinischen Wort für Insel. Der Duden definiert das Verb so: „jemanden, etwas von anderen, von seiner Gruppe trennen, jemanden, etwas, sich absondern“.
Das wohl berühmteste Buch über die dunkle Seite von Inseln hat der Brite William Golding geschrieben: In Herr der Fliegen strandet eine Gruppe englischer Jungen auf der Flucht vor einem Atomkrieg auf einem einsamen Eiland. Einige von ihnen sind überzeugt, dass das Überleben ein Klacks sei, schließlich seien sie „Engländer, und Engländer sind in allem am besten“. Schritt für Schritt schälen sich die Kinder jedoch aus der Hülle der Zivilisation und töten sich gegenseitig. <…
Eine kleine Insel des Königreichs Tonga im Südpazifik: Orte wie diese faszinieren und inspirieren. Und sie zeigen uns, wie wir den Kampf gegen die Klimakrise meistern.