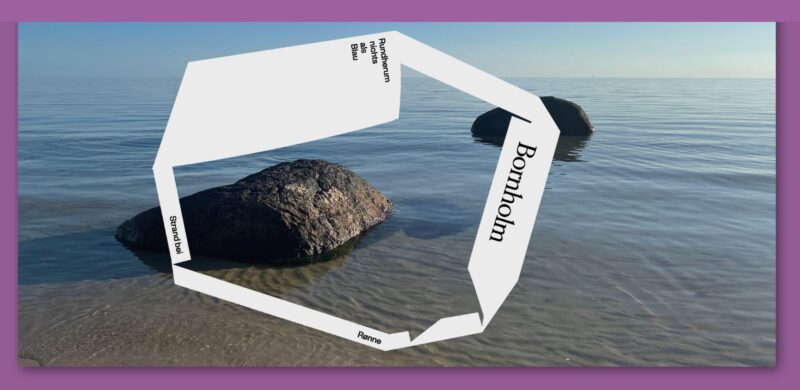Martin Nweeia hat sich mittlerweile daran gewöhnt. An den hautengen Trockenanzug, der seine Knöchel und Handgelenke fest umschließt, die schwerfälligen Bewegungen im Wasser, an das Gefühl, wenn die Finger langsam steif werden. Doch eines wird wohl immer besonders bleiben: Wenn sich das Meer um ihn herum plötzlich bewegt, zu einer Strömung formt – und aus dem Blau ein Schatten auftaucht, langsam, riesig, ganz ruhig. Eine fünf Meter lange, lebende Landschaft mit marmorierter Haut und einem spiralförmigen Stoßzahn, der bis zu drei Meter lang werden kann – und eigentlich ein verlängerter Eckzahn ist, durch den Millionen von Nervenenden laufen.
Doch bevor man ihn sieht, spürt man ihn. Den Narwal. Sein Pfeifen, Klicken und Summen, das man mit dem ganzen Körper fühlt. Wie sanfte Vibrationen, die durch den Brustkorb gehen. „Narwale sind majestätisch, in ihrer Nähe zu sein, erfüllt mich mit Demut“, sagt Nweeia, lächelt in die Facetime-Kamera. Er sitzt zu Hause auf seiner Couch in Sharon, Connecticut, fährt sich durch die kurzen Haare und über die buschigen Augenbrauen. Nweeia arbeitet an der Universität Harvard und am Polarinstitut des Wilson Center. Mehr als 20 arktische Expeditionen hat er geleitet – und gilt weltweit als Pionier in der Narwal-Forschung.
„Nahezu alles an ihnen ist einzigartig“, sagt Nweeia. Narwale haben keine Rückenflosse, eine der dicksten Fettschicht aller Wale, leben ausschließlich in arktischen Gewässern und gehören mit bis zu 1.800 Metern zu den am tiefsten tauchenden Walen. Um sie zu erforschen, fangen Nweeia und sein Team meistens einige hundert Meter entfernt von der Küste einen Wal mithilfe eines Netzes und bringen ihn vorsichtig in seichtes Gewässer. „Wir haben 30 bis 40 Minuten, um Experimente an ihm durchzuführen – danach lassen wir ihn sofort frei.“
An einen Moment erinnert er sich noch genau: Mitte August 2005, Nweeia steht im seichten Meer, vor ihm ein Narwal. An diesem Tag ist er besonders aufgeregt, denn er probiert seine neueste Erfindung aus: ein Gerät, das Herz- und Hirnaktivität der Säuger misst. Monatelang hat er an seinem schwimmenden Labor gearbeitet, an Saugnäpfen gebastelt, die an Walhaut haften, Kabel in wasserdichte Isolierung gepackt. „Doch dann wurde ganz schlagartig, wie aus dem Nichts, mein rechtes Bein komplett taub.“ Nach einigen Sekunden kehrt das Gefühl zurück. „Ich bekam Panik. Gab es ein Leck im Kabel? Und warum nur ein Bein?“

Einen Monat später schickt er die im Wasser aufgezeichnete Tonspur an einen Sound-Experten am Woods Hole Oceanographic Institute. Was der herausfindet, stellt die bisherige Forschung auf den Kopf: Narwale nutzen nicht nur Echolokalisierung – eine Technik, die viele Meeressäuger verwenden, um sich in Gewässern zurechtzufinden –, sondern auch ihren Stoßzahn zur Schallmanipulation. Sie lenken und verstärken Schallwellen. „Verrückt – der Narwal hat es geschafft, Schallwellen direkt auf mein Bein zu richten. Vielleicht als ein Hinweis: Hey, du bist im Weg, geh mal weg.“
Mehr Orcas, weniger Narwale
Narwale nutzen die Klicklaute, um ihre Umgebung zu sehen, während der Jagd zu navigieren und mit anderen aus der Gruppe zu kommunizieren. Das Problem: Genau das wird ihnen jetzt erschwert. Denn das Eis in der Arktis schmilzt in einem rasanten Tempo. Prognosen sagen voraus, dass die Arktis im Sommer schon ab 2030 eisfrei sein könnte. Das führt zu drastischen Umweltveränderungen. „Mehr Orcas dringen in das Gebiet der Narwale vor, die sonst dichtes Eis als Schutz nutzen oder um sich auszuruhen“, sagt Nweeia. Viele Fischbestände wandern ab – und Narwale müssen weiter reisen, um Nahrung zu finden.
Und dann sind da noch menschlicher Dreck und Lärm. „Durch das Abschmelzen von Eis entstehen neue Seewege, für Fracht-, Kreuzfahrt- und Containerschiffe, U-Boote, Öltanker und Eisbrecher“, sagt Nweeia. Seit 1990 hat sich die Zahl der Schiffe mehr als verdoppelt. Das Röhren der Motoren stört die Echolokalisierung der Meeresbewohner, außerdem setzen all diese Schiffe Abgase, Abwasser und Öl ins Meer frei.
Auch seismografische Messungen – eine Methode, bei der starke Schallwellen ins Wasser geschickt und extrem laute Explosionen eingesetzt werden, um nach Öl und Gas unter dem Meeresboden zu suchen – sind gefährlich. Der Schall verscheucht Fische, Krill und Krebse, die Nahrungsgrundlage der Narwale, und kann die Säuger orientierungslos und sogar langfristig taub machen. „Letztens wurde ein Narwal in Europa gesichtet, das ist nicht normal“, so Nweeia. Gleiches gilt für Tiefseebohrungen, die kilometertiefe Löcher in den Meeresboden bohren.
Das alles ist nicht nur für Narwale gefährlich, sondern hat Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem der Arktis – eines der sensibelsten der Welt. Julia Ehrlich von der Universität Rostock erforscht den Einfluss des Klimawandels auf Biodiversität und Ökosysteme von Arktis und Antarktis. „Weil die Luft- und Ozeantemperatur steigen, bildet sich Meereis später im Jahr und viel weiter im Norden“, erklärt sie. „Weniger Eis bede…
Narwale spüren, was wir überhören: Das Ende ihrer Welt naht