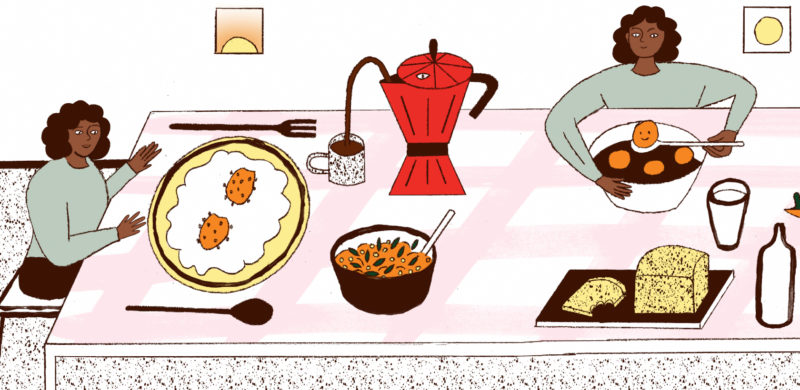Werkstätten für behinderte Menschen, kurz WfbM, sind eine gute Sache. Das findet zumindest Hubertus Heil. „Die sind für viele Menschen wichtig“, sagte der Bundesminister für Arbeit und Soziales Ende März in seinem Podcast „Das Arbeitsgespräch“. Heil plauderte entspannt mit der Autorin Laura Gehlhaar über das wichtige Thema Inklusion, und wie gut sie in Deutschland funktioniert. Ein mahnendes Fazit des SPD-Politikers: „Die große Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass wir nicht nur gut durch die Krise kommen, sondern dass die Krise nicht zur Inklusionsbremse wird.“ Das betreffe insbesondere die Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Die Plattform entia.de arbeitet mit mehr als 100 Werkstätten in Deutschland zusammen. Ihr Produktionspektrum reicht vom Grill über Möbel bis hin zu Hosenträgern. Auf der Website heißt es: „Lassen Sie sich von den modernen, hochwertigen Produkten in bester Manufaktur-Qualität überzeugen. Hier kann man wirklich mit einem guten Gefühl shoppen!“
Was der Bundesminister Heil und entia.de nicht ganz so laut sagen ist, mit welcher Bezahlung das gute Shopping-Gefühl einhergeht. Wie hoch ist also der Monatslohn, der formell „Arbeitsentgelt“ heißt, aller mehr als 300.000 behinderten Werkstattarbeiter:innen? 2019 waren es gerade mal 155 Euro im Bundesschnitt, dazu kommen das staatlich geregelte Arbeitsförderungsgeld von 52 Euro und weitere existenzsichernde Sozialleistungen. Der Umsatz aller 786 WfbM mit fast 3000 Betriebsstätten in Deutschland dagegen ist gewaltig: etwa acht Milliarden Euro.
Werkstätten für behinderte Menschen sind ein geschlossenes, intransparentes System, das auf einer sehr eigenen Definition von Arbeit, Lohn und Teilhabe fußt. In der Pandemie hat sich das wie unter einem Brennglas gezeigt: Durch Corona verschlechterte sich vielerorts die Auftragslage. In mehreren Einrichtungen wurde der spärliche Lohn der behinderten Menschen gekürzt, während die nicht behinderten Angestellten mit Tarifverträgen – Sozialarbeiter:innen, Gruppenleiter:innen oder Verwaltungsangestellte etwa – keine Gehaltseinbußen hatten. Läuft da etwas gewaltig schief? Fangen wir mit einem Blick in die Geschichte an.
Werkstätten für behinderte Menschen: Vorläufer in den 1960er-Jahren
Als mitentscheidend für die Etablierung der Werkstätten für behinderte Menschen gilt die Gründung des Vereins Lebenshilfe 1958. Der Verein ist mit heute 223 WfbM neben den Kirchen einer der wichtigsten und einflussreichsten Träger. Bundesvorsitzende ist die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Erste Vorläufer nicht-stationärer Werkstätten entstanden in den 60er-Jahren. 1974 fand die Bezeichnung „Werkstatt für Behinderte“ Eingang in die Rechtsnormen. 1980 trat die rahmengebende „Werkstättenverordnung“ in Kraft.
Die heutige Form der „Werkstätten für behinderte Menschen“ wurde 2001 mit dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch, kurz SGB IX, etabliert. Es regelt vor allem die gesellschaftliche Teilhabe von behinderten Menschen. Dort steht in Paragraph 219 Folgendes: „Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben (…) und zur Eingliederung in das Arbeitsleben.“ Weiter heißt es: „Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.“
Diese Sätze kennt Ulrich Scheibner auswendig. „Die Gesetze sind gut“, sagt er, „es hapert seit jeher an der Umsetzung.“ Scheibner kennt sich in der Geschichte und Rechtspraxis der Werkstätten sehr gut aus. Der Sozialarbeiter war fast 25 Jahre lang Geschäftsführer des zuständigen Dachverbands, der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen. Bis heute berät er Einrichtungen und kämpft vor allem für die Rechte behinderter Menschen.
Der 73-jährige stellt die gesetzlichen Aufgaben des Werkstätten-Systems nicht in Abrede, aber kritisiert: „Mindestens 30 Prozent der ,Werkstatt‘-Beschäftigten sind eigentlich Arbeitnehmer:innen.“ Er meint: Mindestens 90.000 dieser behinderten Erwachsenen müssten in jedem Fall den gesetzlichen Mindestlohn und damit 9,50 Euro pro Stunde bekommen statt den derzeitigen Durchschnittsstundenlohn von 1,11 Euro. Das hält er für eine „skandalöse Benachteiligung“ der sogenannten Leistungsträger:innen oder „,Werkstatt’-Arbeiter:innen“ auf den ausgelagerten Arbeitsplätzen in der Wirtschaft. Dort sind 20.000 behinderte Menschen wie Leiharbeiter:innen beschäftigt – ohne Anspruch auf den Tariflohn im entsprechenden Unternehmen.
Interne Statistik des Bundesarbeitsministeriums
Und: in punkto Lohn gibt es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Das Bundesarbeitsministerum führt darüber eine interne Statistik, die dem enorm Magazin vorliegt. Schaut man sich die Jahre 2017 bis 2019 an, also die Zeit vor der Pandemie, finden sich in einzelnen Fällen sehr bedenkliche Zahlen. Generell wird im Westen mehr gezahlt als im Osten der Republik: Im Schnitt waren es vor zwei Jahren 166 Euro im Westen, in Bayern gar 204 Euro, in Hessen und Nordrhein-Westfalen 144 Euro. Der Schnitt im Osten betrug 113 Euro, Spitzenreiter ist Thüringen mit 164 Euro. In Sachsen erhielten allerdings 2019 die 16.300 Werkstättenbeschäftigten deutlich weniger als die Hälfte dessen, was im Nachbarland gezahlt wird: 64 Euro. Im Jahr 2018 waren es 62 Euro, ein Jahr zuvor betrug der Monatslohn 57,75 Euro. Umgerechnet in Stundenlöhne heißt das: weniger als 50 Cent in den Jahren 2017 bis 2019.
Die Zahlen aus Sachsen sind auch deswegen so brisant, weil sie klar unter dem gesetzlich festgelegtem Minimum liegen, dem Grundbetrag. Dieser betrug laut Sozialgesetzbuch IX, Paragraf 241 „mindestens 80 Euro“. Neben dem Grundbetrag, wird zudem eigentlich noch ein leistungsabhängiger Steigerungsbetrag ausgezahlt, dieser fällt somit auch in Sachsen im Schnitt komplett weg. Die Kürzungen in Sachsen sind aber dennoch nicht rechtswidrig. Wie geht das?
Nun wird es etwas kompliziert: Neben dem Sozialgesetzbuch IX gibt es noch die ebenfalls geltende Werkstättenverordnung. Hier ist in Paragraf 12 geregelt, dass die „Arbeitsentgelte“, also die Löhne der beschäftigten Menschen mit Behinderungen, aus dem „Arbeitsergebnis“, also dem Geld, das die Werkstätten dank ihrer Produktion einnehmen, zu zahlen sind. Das „Arbeitsergebnis“ wiederum soll in erster Linie eingesetzt werden, um die Löhne zu zahlen – und Rücklagen zu bilden, damit in schlechten Zeiten die Entgelte weitergezahlt werden können.
Konkret heißt das: Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderungen müssen ihre Löhne selbst erwirtschaften. Ist die Auftragslage schlecht, ist das „Arbeitsergebnis“ also gering, dann dürfen die Löhne gekürzt werden, wenn es keine…
Im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) läuft es wie in anderen Unternehmen auch, wo noch sortiert, geklebt, gesägt, gebohrt und verpackt wird – mit dem gravierenden Unterschied der Entlohnung. Im Schnitt erhalten Beschäftige 1,11 Euro pro Stunde.