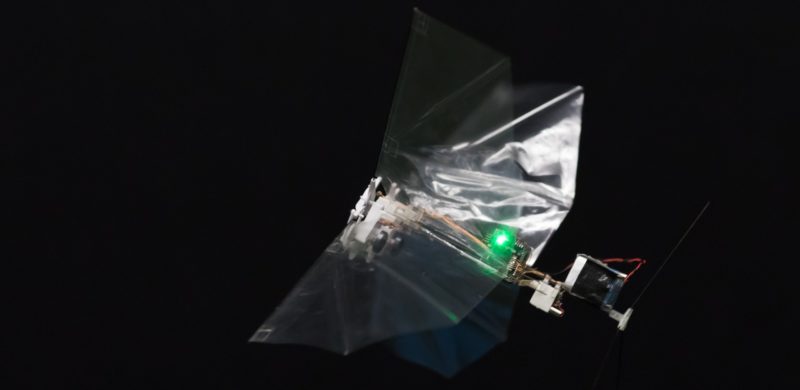1.161,5 Milliarden Euro wurden 2021 in Deutschland für soziale Leistungen ausgegeben – nämlich rund 400 Milliarden für Krankheit, 350 Milliarden fürs Alter (also insbesondere Renten), 125 Milliarden für Kinder, 100 Milliarden für Invalidität, 75 Milliarden für Arbeitslosigkeit und Wohnen und 60 Milliarden für Hinterbliebene sowie immerhin über 40 Milliarden als Verwaltungsausgaben. Das ist eine Menge Geld – nämlich rund ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Trotzdem lässt sich anzweifeln, ob es reicht, um Menschen ein soziales Mithalten zu finanzieren und vor einem ökonomischen Niedergang zu bewahren. Zu offensichtlich ist die Schieflage des heutigen Sozialstaates angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts:
Der demografische Wandel führt dazu, dass zu wenig junge Menschen nachfolgen, um alle zu er- setzen, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Die Folge: Der heutige Sozialstaat lässt zu, dass kommende Generationen durch stetig weiter steigende Rentenbeiträge über Gebühr belastet werden.
Der gesellschaftliche Wandel ergänzt und ersetzt das traditionelle Familienverständnis durch neue Formen des Zusammenlebens und ein anderes Rollenverhalten von Eltern. Private wie berufliche Brüche werden häufiger. Doch der Sozialstaat kann bislang nicht verhindern, dass alleinerziehende Frauen von heute die Altersarmen von morgen werden. Im Gegenteil: Der heutige Sozialstaat diskriminiert Frauen und privilegiert Männer.
Die Digitalisierung hat einen strukturellen Wandel ausgelöst, der dazu zwingt, Sozialversicherungen nicht mehr über Arbeitslöhne zu finanzieren, sondern stattdessen über die Wertschöpfung – also direkt da, wo Werte in der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen geschaffen werden. Das heißt, Erträge von Automaten, Algorithmen und künstlicher Intelligenz sind in die Solidarpflicht miteinzubeziehen. Es kann und darf nicht sein, dass die Arbeit von Menschen über die Einkommenssteuer besteuert wird, die Arbeit von Robotern aber davon befreit bleibt. Beides muss steuerlich genau gleich belastet werden.
Bedingungsloses Grundeinkommen für alle
Das Grundeinkommen will diesem demografischen, gesellschaftlichen und strukturellen Wandel gerecht werden. Es wird vom Staat ein Leben lang – also vom Säugling bis zur Greisin – in identischer Höhe an jeden einzelnen Menschen ausbezahlt, völlig unabhängig davon, mit wem sie wie leben, wie alt sie sind oder was sie tun. Und es wird aus der gesamten Wertschöpfung der Wirtschaft finanziert.
Natürlich würde es billiger, wenn Kinder nur etwa die Hälfte des Grundeinkommens erhielten. Als Mitwohnende in einem Familienhaushalt verursachen sie schließlich geringere Alltagskosten als Erwachsene. Die direkten Unterhaltskosten sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Viel gravierender: die indirekten Kosten, insbesondere in Form des Zeitaufwands für die Kinderbetreuung und -erziehung. Wer Kinder hat, tut sich schwer, Freiräume zu finden, die für berufliche Zwecke genutzt werden könnten. Oft gilt es, die Entscheidung „Kind oder Karriere“ zu treffen. Dass die Verzichtskosten nicht nur Kleckerbeträge, sondern gewaltige Summen darstellen, wissen vor allem Frauen. Noch immer sind es meist Mütter, die wegen des Nachwuchses auf eigene Berufserfolge und damit verbundene höhere Gehälter verzichten. Wem Fachkräftemangel und demografische Alterung Sorgen bereiten, muss daran interessiert sein, dass mehr Kinder geboren werden. Ein Grundeinkommen in gleicher Höhe auch für Kinder könnte das begünstigen.
Menschen sollen immer wieder von Neuem ermächtigt werden, sich geänderten Umständen rasch anpassen zu können – ohne große Bürokratie, Anträge oder Auflagen. Grundeinkommensmodelle verstehen gebrochene Lebensläufe nicht als Ausnahme, sondern als Regel. Sie behandeln berufliche Neuorientierung nicht als Bedrohung, sondern als Notwendigkeit.
Warum bedingungslos so wichtig ist
Weil niemand weiß, wie die Digitalisierung das Zusammen- leben und die Wirtschaftswelt verändern wird, weil Komplexität und Ungewissheit zunehmen, sollten sozialpolitische Maßnahmen nicht zu viele Vorgaben machen oder Bedingungen festlegen. Zu groß ist ansonsten die Gefahr, Anreize zu setzen und Signale auszusenden, die nicht mehr dem Lebensalltag des 21. Jahrhunderts entsprechen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Erwerbslose von Arbeitsagenturen in Jobs gedrängt werden, die eigentlich längst durch Maschinen erledigt werden könnten. Seien es Selbst-Check-out-Automaten statt Kassierer:innen oder automatische U-Bahnen. Deshalb ist die Forderung nach einer „Bedingungslosigkeit“ der Sozialpolitik in Form eines Grundeinkommens so wichtig. Denn wer kennt schon die „richtigen“ Bedingungen in einer Welt des raschen Wandels?
Im Kern ist das Grundeinkommen nichts anderes als eine fundamentale Steuerreform. Es bündelt alle sozialpolitischen Maßnahmen in einem einzigen Instrument, dem bedingungslos und steuerfrei ausbezahlten Grundeinkommen. Dabei ist natürlich die Frage entscheidend, wie weit das Grundeinkommen den heutigen Sozialstaat und insbesondere die Sozialversicherungen fürs Alter und im Falle von Krankheit, Pflege oder Arbeitslosigkeit ergänzen oder ersetzen soll. Logisch ist: Je mehr gefordert wird, zu ergänzen, statt zu ersetzen, umso höher werden die Finanzierungskosten sein.
Fair finanziertes „Geld für alle“
Das Grundeinkommen soll an alle in gleicher Höhe ausbezahlt werden. Damit wirkt es „regressiv“: Für Menschen mit wenig Geld sind Tausend Euro viel bedeutsamer als für Wohlhabende, die Millionen haben. Finanziert wird das „Geld für alle“ durch die direkte Steuer. Das wiederum wirkt sich „progressiv“ aus: Wer besser verdient, wird mit einem höheren Steuersa…
Ein Grundeinkommen könnte in Zeiten der Dauerkrise einen Schutzschild bieten.