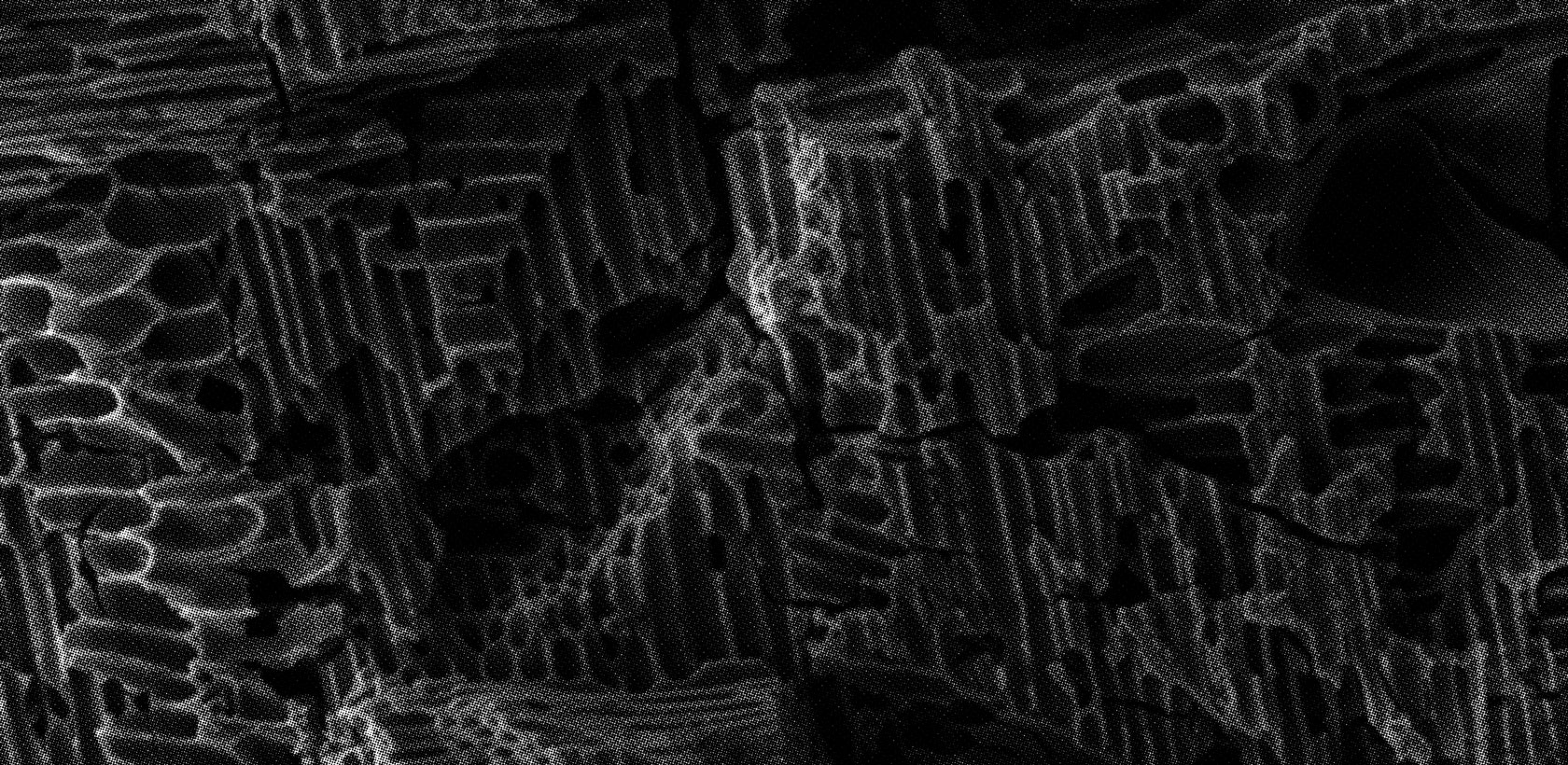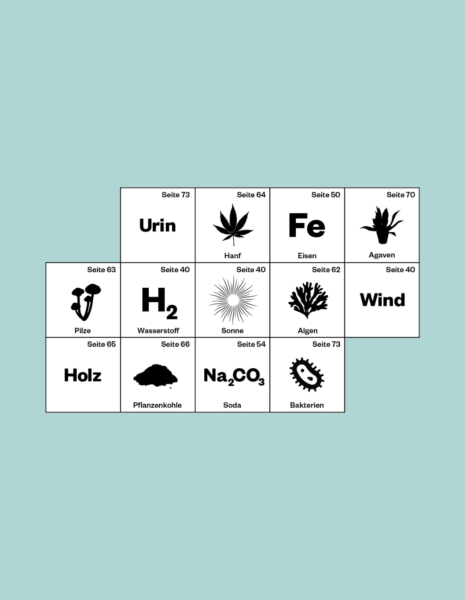Pflanzen scheinen perfekt in Sachen Kreislaufökonomie: Sie fangen CO2 aus der Luft und binden es als Kohlenstoff. Sobald sie verrotten, geben sie das Kohlenstoffdioxid wieder frei. Doch es ist möglich, CO2 sogar langfristig der Atmosphäre zu entziehen: indem Pflanzen verkohlt und so zu festem Kohlenstoff werden. Lange schon machen Menschen aus Biomasse Holzkohle, um sie zu verheizen oder damit zu düngen. Terra Preta nennt sich die tiefschwarze, fruchtbare Erde, die indigene Menschen seit Jahrtausenden im Amazonasgebiet schaffen, wofür sie Pflanzenkohle unter anderem mit Dung vermengen. Die poröse Struktur macht Pflanzenkohle zum idealen Speicher für Mikroorganismen, Nährstoffe und Wasser.
Heute entsteht Pflanzenkohle immer häufiger in effizienten Hightech-Anlagen. So kann das Material als Baustoff oder Kunststoffersatz verwendet werden und die Kompostierung von Bioabfällen verbessern. Bei der Herstellung von Pflanzenkohle lässt sich sogar nachhaltig Energie erzeugen. Beim Verkohlen, der Pyrolyse, werden Pflanzenreste wie Grünschnitt, Restholz oder Abfallprodukte der Lebensmittelherstellung sauerstoffarm bei Temperaturen meist zwischen 400 und 750 Grad thermisch behandelt. Dabei trennen sich die Kohlenstoffverbindungen in Pyrolyse-Öl und -gase – mögliche Treibstoffe – und in die feste Pflanzenkohle.
Um das Potenzial des schwarzen Materials zu begreifen, hilft ein Gespräch mit Kathleen Draper. Sie ist US-Direktorin des Ithaka Instituts, eines internationalen Netzwerks für Kohlenstoff-Strategien, und Co-Autorin des Buches Burn: Using Fire to Cool the Earth (2019). Beim Videogespräch sitzt sie in ihrem Büro im Bundesstaat New York. „Moment“, sagt sie, eilt zu einem Regal hinter sich und hält einen dunkelgrau gesprenkelten Ziegelstein in die Kamera: „Der besteht aus recyceltem Plastik und Pflanzenkohle. Ich habe ihn mit meinen Studierenden in Gambia gemacht. Gerade für Länder, in denen es keine etablierten Plastik-Recyclingsysteme gibt, sind solche Anwendungen toll.“ Sie deutet neben sich: „Diese Wand enthält etwa 500 Gramm Pflanzenkohle, aber auch Materialien wie recyceltes Glas.“ Draußen, erzählt sie, stehe eine Klärgrube mit Pflanzenkohle – als reinigendes Filtermedium. „Solche Lösungen machen so viel Sinn.“ Draper forscht seit Jahren zu Pflanzenkohle, die immer mehr in den Fokus rückt. „Die Reise beginnt gerade erst.“
Böden verbessern
Der ursprüngliche Nutzen von Pflanzenkohle, also Böden zu verbessern, ist heute wissenschaftlich gut erforscht. Mitte 2022 könnte die neue EU-Düngemittelverordnung die landwirtschaftliche Anwendung ankurbeln: Darin werden weitere Ausgangsmaterialien für Pflanzenkohle zugelassen. Bislang erlaubt Deutschland etwa nur, Pflanzenkohle aus chemisch unbehandeltem Holz in den Boden einzubringen. Susanne Veser, Vorsitzende des Fachverbands Pflanzenkohle, kritisiert: „Es gibt keinen rationalen Grund, warum man den Einsatz hochwertiger Pflanzenkohle aus Grünschnitt oder Abfällen aus der Lebensmittelindustrie verbieten sollte.“ Auch Zertifikate wie das European Biochar Certificate sichern die Qualität, mit Grenzwerten für gesundheitsschädliche Stoffe.
Doch nicht jeder Boden profitiert gleichermaßen, weiß Dominic Woolf von der US-amerikanischen Cornell Universität. „Pflanzenkohle nützt eher Böden, die degradiert sind oder weniger gut Nährstoffe halten können.“ Dort kann sie dazu beitragen, dass mehr Humus entsteht und die Feuchtigkeit besser gehalten wird. Studien zeigen, dass der Ernteertrag in tropischen Regionen um durchschnittlich 25 Prozent gesteigert werden kann. Obendrein reichert sich Nitrat an der Pflanzenkohle an, das schützt das Grundwasser. Bevor sie zum Düngen in den Boden kommt, muss Pflanzenkohle mit Tier-Mist oder Kompost vermengt und so mit Nährstoffen angereichert werden, die sie anschließend an die Erde abgibt.
Großes Potenzial liegt für Veser vom Fachverband im Zusammenspiel von Pflanzenkohle-Anlagen und Bioabfall-
Porös, kohlenstoffhaltig, schwarz und vielseitig einsetzbar: Pflanzenkohle ist ein Rohstoff der Zukunft (hier unterm Mikroskop).