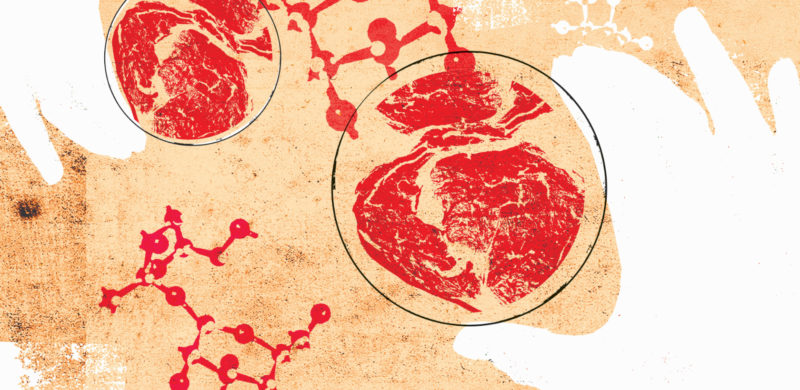Clara Sandorn*, 27, Sozialpädagogin, München
„Meinen Job kann ich nur machen, weil ich meine Grenzen kenne – ich weiß, wo sie verlaufen, da ich selbst eine Therapie gemacht habe. Ich arbeite in der Familienhilfe und kümmere mich um Kinder, die drogenabhängige oder psychisch erkrankte Elternteile haben. Das ist sehr stressig. Bei Rufbereitschaft muss ich auch spät nachts los. Neulich war ich allein mehrere Stunden bei einer Mutter, die einen Alkohol-Rückfall hatte, ihr kleines Kind stand verstört in der Ecke des Zimmers. Ich musste beide nacheinander beruhigen. So eine Balance zwischen Nähe und Distanz ist nicht einfach, weil man eine starke Bindung zu den Familien aufbaut. Auf meine Fälle muss ich mich detailliert vorbereiten, die Geschichten der Betroffenen kennen, mich ständig mit Kolleg:innen absprechen.
In extremen Situationen hilft es mir, mein Ziel, meine Aufgabe klar im Kopf zu haben. Also: ,Das Kind muss sicher sein.‘ Alles kann ich nie schaffen. Sich einzugestehen, dass einem etwas zu viel wird oder man etwas nicht kann, ist eine Stärke. Manchmal muss ich die Kontrolle abgeben, das fällt mir schwer. Wenn es zu heftig wird, gehe ich kurz raus an die frische Luft, atme tief ein, hole mir Verstärkung oder bei Gefahr die Polizei. Das muss man kommunizieren. Ich teile meinen Klient:innen mit, wenn mir etwas zu laut ist oder ich mich unwohl fühle. So mache ich das auch außerhalb meines Berufs – wenn ich einen Konflikt mit Freund:innen oder meinen Eltern habe oder mich etwas nervt. Nur du selbst kannst Verantwortung für dich übernehmen.
Über die Jahre habe ich Routinen entwickelt: Direkt nach der Arbeit lese ich keine Nachrichten, checke mein WhatsApp nicht, beschäftige mich nicht mit privaten Problemen. Es ist wichtig, Dinge ruhen zu lassen. Es bringt nichts, auf die große Auszeit zu warten, der nächsten Reise oder dem Wochenende entgegenzufiebern. Ich baue mir stattdessen über den Tag verteilt kleine Mini-Urlaube ein, gehe spazieren, male die Nägel an, höre meinen Lieblingssong oder zeichne etwas. Und: Am Wochenende bleibt das Arbeitshandy aus. Wenn ich das nicht mache, nehme ich die Wut und die Trauer der Familien mit.“

Tilo Timplan, 43, Freiwillige Feuerwehr, Bernburg, Saale
„Es gibt Einsätze, die einem selbst nach 25 Jahren Erfahrung nicht aus dem Kopf gehen. Ich engagiere mich bei der Freiwilligen Feuerwehr und arbeite heute ehrenamtlich als Stadtwehrleiter. Einige unserer Truppe haben nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg vor Ort geholfen. Ich habe Freunde, die ihre Kinder gerade noch wegziehen konnten. Ich versuche, das nicht an mich ranzulassen, aber natürlich bewegt es mich. Das habe ich mit der Zeit gelernt. Man darf die Nerven nicht verlieren – auch nicht bei schlimmen Einsätzen. Anderes Beispiel: Vor ein paar Jahren fuhr ein Lastwagen auf der Autobahn in einen Transporter, den er bis auf einen Meter zusammenschob. Drei der Insassen starben, einen der Männer versuchten wir zu befreien. Nur sein Arm guckte noch raus. Acht Stunden hat das gedauert. So was brennt sich ein. Genau wie die Schreie einer Mutter, wenn ihr Kind bei einem Unfall umgekommen ist. In einem brennenden Haus sehe ich manchmal meine Hand vor Augen nicht. Wenn man dann plötzlich einen Körper ertastet, spielt das Herz verrückt.
Auf die Feuerwehr verlassen sich andere Menschen. Psychisch und physisch muss man fit sein, in Sekundenschnelle Entscheidungen treffen. So hart es klingt: Die Schicksale schalte ich aus – und versuche doch, empathisch zu bleiben. Einen Bilderbuch-Einsatz gibt es nicht. Abläufe vorab zu planen ist aber hilfreich. Auch auf Extremsituationen kann man sich vorbereiten, Strategien lernen. Meine Ausbildung und die vielen Coachings in Stress- und Konfliktbewältigung waren gut. In meiner Freizeit mache ich gezielt Dinge, die mich Überwindung kosten. Das gibt mir Selbstvertrauen. So habe ich letztens die Himmelsleiter am Donnerkogel bestiegen, einen 40 Meter langen schwebenden Klettersteig.
Gibt es Stress daheim, gehe ich spazieren, höre Entspannungsmusik, mache einen Powernap. Besser, als sich stundenlang im Kreis zu drehen. Mit meiner Frau spreche ich über meine Arbeit und meine Sorgen, von meinen Kindern halte ich das fern. Wenn ich höre, was auf der Welt passiert – Krieg, Anschläge, der Rechtsruck in Deutschland – habe ich Angst um meine Familie. Dann nehme ich mir die Zeit, egal, wo ich gerade bin, und drücke den Pausenknopf: Fokus nach innen, durch den Bauch atmen, ruhig bleiben.“
*Namen von der Redaktion auf Wunsch der Interviewten geändert. Sie sind der Redaktion bekannt.
Schmatzen, spielen, Nachbargeschrei – sehr Unterschiedliches kann stressig sein