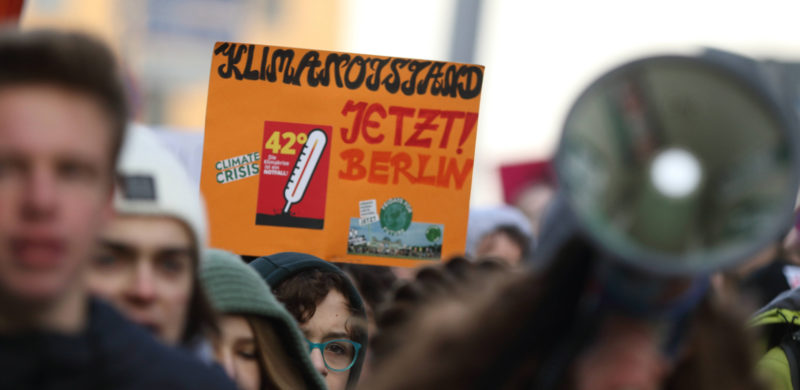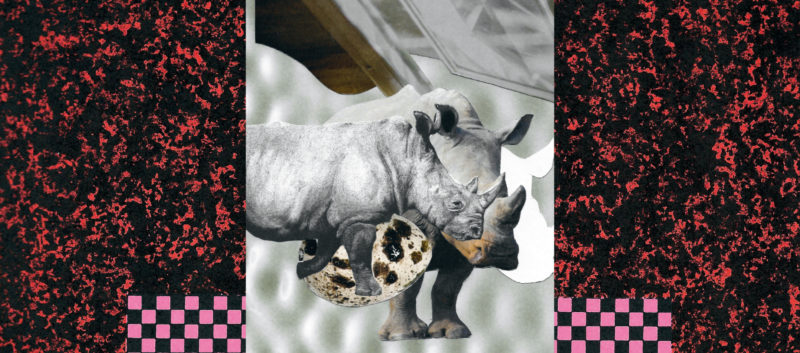Von Palau über Mauritius bis nach Großbritannien: Tausende Kilometer geschützter Meeresraum umgeben diese Inseln. Das tiefe Blau zu bewahren, ist ihre Überlebensgarantie. Gerade Inselstaaten sind Vorreiter im Meeresschutz, andere Nationen ziehen nach: Waren 2000 nur 0,7 Prozent der Ozeane geschützt, sind es jetzt 7,7 Prozent.
Im Oktober steht ein wichtiger Schritt zum Schutz der Meere bevor: Die Vertragsstaaten des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt sollen ein neues Rahmenwerk verabschieden. Sie wollen 30 Prozent der Meere bis 2030 schützen, wie viel davon streng, steht bisher nicht fest. Derzeit sind laut Marine Protection Atlas nur 2,7 Prozent vollständig oder in hohem Maße geschützt.
„Meeresschutzgebiete sind nach wie vor das beste Werkzeug, um marine Arten und Lebensräume zu erhalten. Aber wir müssen das wirksam umsetzen“, sagt Kim Detloff, Leiter Meeresschutz beim Naturschutzbund (Nabu). Teilweise wird in Schutzgebieten weiterhin Fischerei betrieben, Rohstoffe werden abgebaut, es gibt Schifffahrt und Tourismus. Wo das verboten ist, „explodiert die Natur: mehr Arten, mehr Individuen einer Art, größere Tiere“. Zudem steht es nach Taifunen oder Vulkanausbrüchen in streng geschützten Gebieten besser um den Fischbestand. Auch die Wirtschaft profitiert, dank des Spillover-Effekts. Detloff: „Weil die Fläche des Schutzgebietes irgendwann zu klein ist, wandert die gesunde Lebensgemeinschaft ab, so profitieren die angrenzenden Gebiete und auch die Fischerei.“
Meeresschutzgebiete: die Rettung der Artenvielfalt
Meeresschutzgebiete haben jedoch nicht Wirtschaftlichkeit im Sinn, sondern den Schutz von Arten und Biotopen, etwa Korallenriffen. „Korallenriffe sind das Rückgrat des Meeres. Mehr als ein Viertel der marinen Lebensformen brauchen die Riffe für ihre Nahrung, zum Schutz und als Lebensraum“, sagte Emily Higgins beim Korallenriff-Symposium im Juli 2021 in Bremen. Die Wissenschaftlerin arbeitet für das Unternehmen IntelliReefs und entwickelt künstliche Korallenhabitate, um Riffe wiederherzustellen. Meereserwärmung, Korallenbleichen, Ozeanversauerung, Verschmutzung, Überfischung – all das setzt den Riffen zu. „Weltweit sind bereits fast 50 Prozent der Korallenriffe zerstört, marines Leben und Biodiversität sind in Gefahr.“
So auch vor der französisch-niederländischen Karibikinsel St. Martin. An der Küste vor der niederländischen Hauptstadt Philipsburg testet IntelliReefs daher zusammen mit den Stiftungen The Nature Foundation St. Maarten und der eigenen Reef Life Foundation die künstlichen Riff-Strukturen aus Kalkstein, Aragonit und kalziumbindenden Komponenten. Die Elemente aus den neuartigen Ozeanit-Substraten haben eine komplexe Porenstruktur. Sie lassen sich in allen möglichen Formen herstellen und so an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Arten in einer Region anpassen. Mit langen Metallstiften werden die Kunstriffe im Meeresboden verankert. Auf dem Material wachsen gerne kalkhaltige Arten wie Krustenalgen, eine wichtige Voraussetzung für die Ansiedlung von Korallen.
Die Ergebnisse der Pilotstudie sind laut Higgins vielversprechend, vor allem in den Meeresschutzgebieten: Die lokale Artenvielfalt erhöhte sich, das Korallenwachstu…
Positivbeispiel für Meeresschutz: Bewohner:innen der schottischen Isle of Arran erkämpften 2008 die ersten Schutzgebiete der Region. Die Artenvielfalt, die zuvor dramatisch unter Überfischung gelitten hatte, nahm in der Folge langsam wieder zu.