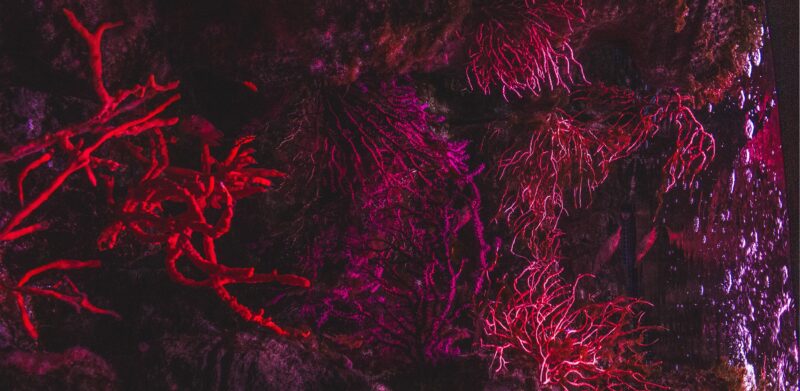Das ist das Problem:
Medizin und Technologie sind nicht mehr voneinander zu trennen: Apps erkennen Herzinfarktsymptome, Gesundheitsforen liefern Präventionsmaßnahmen, Algorithmen sagen Organversagen voraus. Patient:innen vertrauen auf ihre Smartwatch, Mediziner:innen lassen sich bei klinischen Entscheidungen von Künstlicher Intelligenz (KI) helfen. Doch auch wenn die meisten Apps nach dem Geschlecht fragen, arbeiten ihre Algorithmen immer noch mit männlich geprägten Studiendaten. Mehr noch: Der gesamte medizinisch-technische Apparat baut auf einem Fehler auf.
Frauen sind in seinen Daten klar unterrepräsentiert. Dabei können sie – das belegen auch Studien – nur dann evidenzbasierte Prognosen und effektive Therapien erhalten, wenn geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigt werden. Außerdem sollte auch das soziale Geschlecht bei der Datenerhebung und -auswertung eine Rolle spielen. Erleidet etwa ein Transmann einen Herzinfarkt, weist dabei jedoch typisch weibliche Symptome auf, droht eine folgenreiche Fehldiagnose. Und Inter- und Transpersonen sind in den Daten noch weniger repräsentiert als Cis-Frauen.
Das ist der Impuls:
Das „Institute for Gender in Medicine“ an der Universitätsklinik Charité in Berlin will herausarbeiten, in welchen Bereichen die Datenlücke und damit die Gefahr für Frauen am größten ist. Bislang wurde das nicht systematisch erhoben. Aber nur mit getrennten Daten für männliche und weibliche Proband:innen lassen sich geschlechtsspezifische Risikoprofile erstellen.
Erst seit 2022 ist dank EU-Verordnung in klinischen Studien eine repräsentative Geschlechter- und Altersgruppenverteilung verpflichtend. Andere Kriterien, etwa Behinderungen, Gesundheitszustand und Ernährungsweise, finden bislang nur in – nicht verpflichtenden – Richtlinien Berücksichtigung. Expert:innen fordern hier mehr gesetzliche Regelungen.
Das ist die Lösung:
Die Lücke ist groß, es wird Zeit und Engagement brauchen, um sie zu schließen. Erste Schritte könnten so aussehen:
1. Investor:innen finanzieren Unternehmen, die Gesundheitsdaten von Frauen, inter und trans Personen generieren und auswerten, sodass der medizinisch-technische Apparat entsprechend mit Daten gefüttert werden kann.
2. Traditionelle Forschungsmethoden werden überdacht und überarbeitet. Idealerweise arbeiten Regierungen, Wissenschaftler:innen und Expert:innen des Gesundheitswesens dafür zusammen.
3. Auch die Wirtschaft, die schließlich ein Interesse an gesunden Mitarbeitenden aller Geschlechter hat, könnte sich beteiligen.
4. Algorithmen und Künstliche Intelligenz werden anders trainiert und Systeme mit diversen Daten angereichert.
5. Medizinisches Personal wird genderspezifisch geschult, Studium und Ausbildung werden überarbeitet.
Für vieles, was vonnöten ist, fehlt bisher Zeit und Geld. Ob sich die Lage bessert, ist auch eine politische Frage. Doch die Mühe würde belohnt: Eine Welt, in der die Gesundheit aller erforscht ist, dient allen.
Das „Institute for Gender in Medicine“ an der Universitätsklinik Charité in Berlin will herausarbeiten, in welchen Bereichen die Datenlücke von weiblichen Probandinnen und damit die Gefahr für Frauen am größten ist.