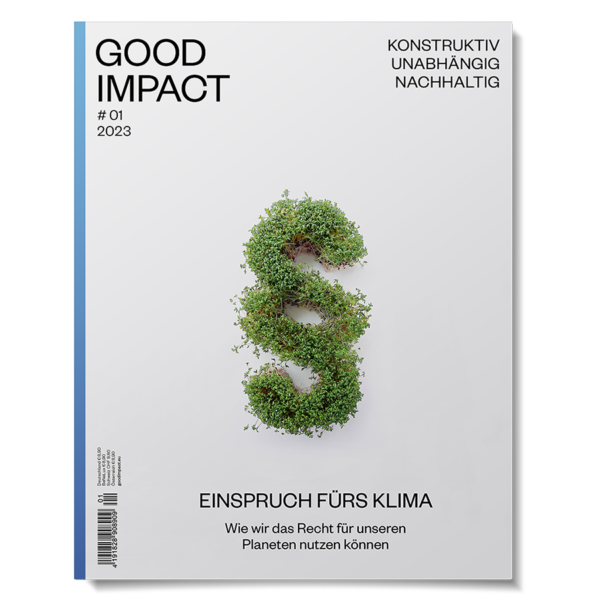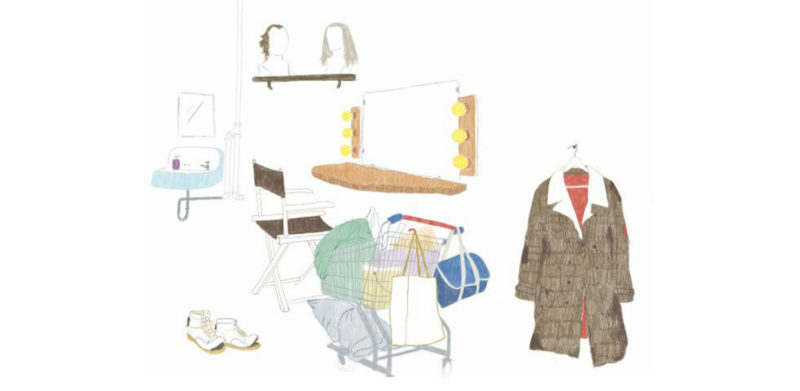Seit einem halben Jahr ist die Angst für Friederike Schlegel* schier unerträglich geworden. Die Angst, dass die drei Euro pro Kopf und Tag für Lebensmittel für sie und ihre vier Kinder (6, 8, 11 und 13) nicht reichen, die der Sozialarbeiterin vom Arbeitslosengeld II nach Abzug aller anderen Kosten bleiben. Die Angst, dass Brot und Milch wieder teurer geworden sind, dass andere schneller waren und ihr das reduzierte Obst und Gemüse in den letzten Minuten des Wochenmarkts weggeschnappt haben.
Längst ist die kraftzehrende Sonderangebotstour durch Supermärkte zu ihrem Alltag geworden, täglich scannt sie Foodsharing-Angebote auf Telegram, klappert die Abholstationen ab. Die Angst, dass die Waschmaschine kaputt geht, die gerade so komische Geräusche macht. Dass die Konflikte mit ihrem Ex-Mann, von dem sie sich vor vier Jahren getrennt hat, nie aufhören. Dass Streit und Gewalt neue Fahrt aufnehmen – und Aron*, Caja*, Emilia* und Finn* dazwischengeraten, auch wenn sie bei ihr leben. Dass ihre psychischen Probleme wiederkommen, die Verzweiflung, weil sie einfach nicht mehr kann, wenn die epileptischen Anfälle des sechsjährigen Finn bis in die Nacht gehen, manchmal sind es achtzig in 24 Stunden.
Die Angst, dass ihr die Kraft ausgeht, es den Kindern so gut wie irgend möglich zu machen: Drachen steigen lassen auf dem Teufelsberg, Tanzstunden für Emilia in einem günstigen Verein, Klavier für Caja wann immer möglich, ein paar Euro Taschengeld für Aron, ihren Teenie. Die Angst, dass es niemals wieder besser wird, denn wie, wann soll sie wieder arbeiten gehen in ihrem Job in der Jugendhilfe mit einem kranken Sohn, der sie braucht? Wie soll sie je rauskommen aus dieser Armut, diesem Leben zwischen Scham und Selbstzweifeln? Und warum, verdammt, interessiert sich eigentlich niemand dafür?
13,8 Millionen Menschen in Deutschland von Armut betroffen
An einem lauen Frühlingsabend im Mai 2022 stößt Schlegel auf einen Hashtag bei Twitter. Da erzählen Menschen, dass sie mit Tränen in den Augen vor der Käsetheke stehen und sich am Monatsende kein Essen mehr leisten können, weil die Stromrechnung explodiert. Dass sie sich nicht trauen, gespendete Lebensmittel bei der Tafel abzuholen, weil sie stundenlang vor den Augen aller Schlange stehen müssen auf dem Gehsteig im Kiez.
Da sind Dutzende Geschichten, die ihrer gleichen. Von Menschen, die eine Scheidung oder Krankheit aus dem prallen Berufsleben in die Armut katapultiert hat. Die sich mit Niedriglohnjobs oder kleinen Renten nicht mehr über Wasser halten können. Deren Wut wächst über eine Gesellschaft, die ihre Bilder von Armut pflegt wie ein lieb gewonnenes Vorurteil: faul, selbst schuld, alles halb so schlimm. Die Menschen, denen Schlegel an jenem Abend auf Twitter begegnet, sagen: Wir wollen nicht länger den Mund halten. Wir wollen zeigen, wie sich das anfühlt, arm sein. „Für mich war das wie eine Befreiung“, sagt die 41-Jährige. Sie beschließt: Ich mache mit bei #IchBinArmutsbetroffen.
Armut in Deutschland? Lange wurde das unter den Teppich gekehrt von einer Wohlstandsgesellschaft, die ungern aushält, was sie in Kauf nimmt: Menschen, die arm sind. Dabei sprechen die Zahlen für sich. 13,8 Millionen Menschen in Deutschland sind laut Paritätischem Armutsbericht 2022 arm: Sie haben weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zum Leben, also 1.148 Euro netto im Monat. Seit 2006 ist das Armutsrisiko damit um knapp ein Drittel gestiegen. Damals waren gut 11 Prozent der Bevölkerung arm, heute sind es 16,6 Prozent.„Armut ist längst kein Randphänomen mehr, sondern schiebt sich in die Mitte der Gesellschaft“, sagt der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge.
Und die Lage verschärft sich stetig. Seit Pandemie-Beginn sind weitere 600.000 Menschen in die Armut gerutscht, vor allem Selbstständige, die Armutsquote bei ihnen stieg von 9 auf 13 Prozent. Inflation und Energiekrise beschleunigen das, sagt Butterwegge. „Wir sehen ein neues Phänomen, schwer statistisch zu erfassen, aber massiv: die verborgene Armut.“ Wo Lebensmittelpreise und Heizkosten explodieren, reicht immer mehr Menschen das Geld nicht mehr zum Leben, auch wenn sie laut Definition noch nicht arm sind. Gleichzeitig nehme die Zahl der absolut Armen zu, die nicht mal mehr ihre Grundbedürfnisse sichern können: Wohnen, Kleidung, Essen. Um vor Armut zu schützen, reichen Grundsicherung, Wohngeld und Bafög längst nicht mehr, resümiert der Paritätische Wohlfahrtsverband und fordert: Anheben, jetzt.
Die Angst wohnt in ihrem Innern
Berlin-Wedding im November. Es ist 16 Uhr und schon dunkel in der Sprengelstraße. In den Cafés klappert das Geschirr, Familien tragen schwere Einkaufstüten nach Hause, eine …
Aktivistin der Initiative #IchBinArmutsbetroffen: Es sind die Stigmatisierung, die Ignoranz und die falschen Mythen, die sich um Armut ranken, die am meisten wehtun, wenn man nicht viel hat (Archivbild).