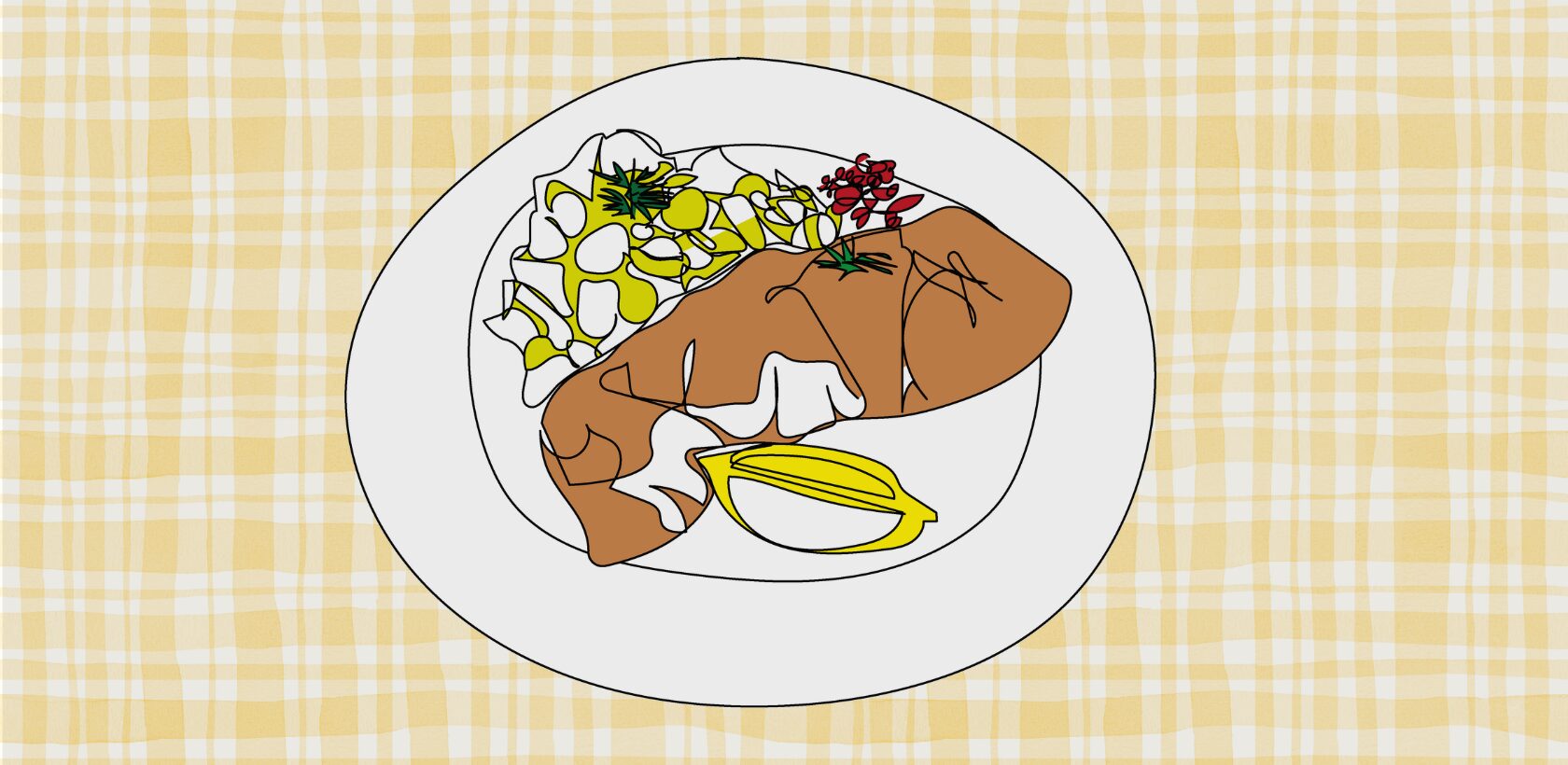Der Doppeldecker steht still, das Summen des Motors längst verklungen, und doch liegt etwas in der Luft. 19 Paar Beine baumeln von den abgenutzten Sitzen. Auf dem Boden verstreut: Bastelzeug, Mäppchen, Brotzeitboxen. Ein paar Kinder flüstern und kichern, andere wippen nervös mit ihren Turnschuhen und nuckeln an ihrer Apfelschorle. Durch die gekippten Fenster dröhnt das Geschrei vom Pausenhof, kalte Herbstluft fegt durch den Spalt. Die Kinder ziehen die Kragen ihrer Jacken nach oben, ihre Augen nach vorne gerichtet.
Sie ahnen: Dieser alte Bus ist irgendwie anders, irgendwie wichtig. „Demokratiemobil“ steht in großen Buchstaben auf der pinken Fassade, aber das Wort hat für die Grundschüler:innen wohl den gleichen Klang wie die meisten Dinge, die Erwachsene sagen – bedeutungsvoll, fern. Noch wissen sie nicht, dass sie heute ein bisschen größer denken müssen als YouTube-Challenges und TikTok-Trends, als Pausenspiele und Mathetests.
„Fahren wir irgendwo hin?“, fragt ein Junge mit blonden langen Haaren, die Ärmel seines Pullovers hängen schlaff über den Händen. Projektleiterin Caro Leder, North-Face-Jacke, kurze Haare, steht vor der 6b und schüttelt den Kopf. „Nö. Ich möchte heute mit euch über Demokratie reden.“
Seit April fährt der umgebaute Bus durch Berlin und bringt politische Bildung zu Schüler:innen und Jugendlichen im Kiez. Queerness, Islam, Feminismus, Antisemitismus, Demokratie – all das soll hier verhandelt werden. Wöchentlich hält er an drei, vier Schulen, heute parkt er im Prenzlauer Berg. Im Team: Caro Leder, Erziehungswissenschaftlerin; Theresa Seidler, Pädagogin; Karl Schweizer, Soziologe; Adrian Lenartowicz, Politikwissenschaftler. „Jede:r bringt andere Erfahrungen mit, in den Bereichen sexuelle Vielfalt, Medienarbeit oder Extremismusprävention etwa“, sagt Leder.
Schule als Ort der Freiheit
Zwar fördert die Bildungsverwaltung das Projekt, die Idee stammt aber von Frauenrechtlerin und Anwältin Seyran Ateş. „Als Kind türkisch-kurdischer Eltern habe ich lange in zwei Welten gelebt“, erzählt sie an einem Nachmittag im Oktober am Telefon, „einerseits in einem patriarchalisch-traditionellen, strengen Elternhaus, andererseits in der Schule, die ich als Ort der Freiheit und Selbstbestimmung erlebt habe. Ich hatte viele junge, engagierte Lehrer:innen, denen es wichtig war, uns ein Verständnis für Politik zu vermitteln.“ Mit 15 war Ateş zwei Jahre lang Schulsprecherin. „Da habe ich gelernt, was Demokratie bedeutet.“
Ateş weiß, wie wichtig demokratische Werte sind. 1984, da war sie gerade mal Anfang 20 und studierte Jura an der Freien Universität Berlin, wurde in einem Frauenberatungszentrum ein Mordanschlag auf sie verübt, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Mitglied der türkischen rechtsextremen Gruppe „Graue Wölfe“. Ateş überlebte knapp, doch eine türkische Frau starb. „Ich habe große Wut gefühlt und sechs Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten, bis heute habe ich Schmerzen. Dann dachte ich: Jetzt erst recht.“ Später gründet sie die liberale Ibn Rushd-Goethe Moschee für progressiven Islam, untergebracht in einer
Kirche in Berlin-Moabit. Provoziert mit dem Buch Der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Und stößt auf Widerstand. So, dass Ateş 24 Stunden am Tag Personenschutz braucht. Ist der Preis zu hoch? „Die Frage stelle ich mir nie.“
Für Ateş ist daher nur logisch: Demokratie muss gelebt werden. Doch genau an einer lebendigen politischen Bildung fehle es oft in Deutschland. Sicher, Demokratiebildung gehört seit den 1970er-Jahren nicht nur zum Lehrplan, sondern ist auch im Schulalltag Pflicht. Hinter dem System von Klassen- und Schulsprecher:innen, von Mitspracherechten auf den Schulkonferenzen, in Bezirks- und Landesschüler:innenvertretungen steht die Idee, demokratische Partizipation einzuüben – und selbst praktisch zu erleben. Doch meist machen nur einige mit. Eine lebendige Schulkultur, die wie ein Parlament im Kleinen permanent neue Ideen für den Alltag entwickelt, darüber abstimmt, debattiert und Kompromisse findet, gibt es nur selten.
Umso wichtiger sind Projekte und Vereine, die sich mittlerweile bundesweit für Demokratiebildung an Schulen einsetzen. Wie das Demokratiemobil. „Wir merken immer wieder in unserer Arbeit: Bei vielen Kindern ist nicht mal das Mi-
nimum an Demokratiebildung da“, sagt Ateş. Viele wüssten nicht, was Partizipation oder Vorurteile bedeuten, sagt auch Erziehungswissenschaftlerin Leder. Manche machen sich lustig: „Demokratie? Kann man das essen oder trinken?“
Hier setzt das Demokratiemobil an. „Wir wollen Schüler:innen die Grundlagen von Demokratie vermitteln und ihnen beibringen, ihre Meinung zu vertreten, auch Autoritäten gegenüber“, sagt Leder. Und zwar ohne ihnen etwas aufzudrängen oder sie zu belehren. Das Demokratiemobil soll schon den Kleinsten einen geschützten Raum dafür bieten. Einen Raum, auch für schwierige, aber notwendige Themen. Im Workshop Salafismus und Rechtsextremismus geht es etwa darum, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ideologien herauszuarbeiten. Leder: „Wir zeigen demokratiefeindliche Tendenzen im Islam auf und versuchen gleichzeitig Vorurteile abzubauen.“ Ein anderer Kurs behandelt muslimischen Antisemitismus – ein Angebot, das nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 wichtig ist.
10 Uhr. Die Kinder rutschen auf den Sitzen im Bus hin und her. „Was ist der erste Begriff, den du mit Demokratie verbindest?“, ploppt als Frage auf den Tablets vor ihnen auf. Schweigen, Grübeln, eifriges Tippen. „Gerechtigkeit“, antwortet Polite Leopard, „Fairness“, tippt Help-ful Bison, „zusammen klar kommen“ gibt ein:e Curious Cat ein. Schlagworte, die die Kinder unter Pseudonymen notieren. Ein Begriff fällt besonders oft: „Olaf Scholz“. „Woher kennt ihr denn den Bundeskanzler?“, fragt Leder. „Mama“, „Handy“, „TikTok“ rufen die Kinder durcheinander. Die Klassenlehrerin lehnt sich zu einem der Mitarbeiter und flüstert: „Ich hätte mit elf nicht gewusst, wer Kanzler ist.“ Adrian Lenartowicz nickt, antwortet leise: „Das sehen wir überall. Die Kinder wissen durch Social Media viel – verstehen aber wenig.“ Einige denken, die AfD säße in der Regierung oder Russland sei eine Demokratie wie die unsere.
Auch mal über gutes reden
Nächste Frage. „Was sind für dich die Nachteile einer Demokratie?“ Wieder flitzen die Finger über die Bildschirme. „Man darf erst ab 18 wählen“, „Alles ist zu teuer, vor allem der Döner“, „Es geht immer um Krieg“. Leder schaut die Kinder an, runzelt die Stirn: „Das muss euch ziemlich belasten.“ Die Kinder nicken. „Ich gucke mir das nicht mehr an, weil ich sonst Angst habe, dass das auch hier passiert“, murmelt ein Mädchen leise. „Mich nervt das. Es passiert doch auch so viel Gutes in der Welt, warum sprechen wir nicht mehr darüber?“, sagt einer der Jungs.
„Bisher ist der Bus fast immer ausgebucht“, sagt Leder. Doch wie misst man den langfristigen Erfolg? „Alle kann man nie erreichen“, räumt Ateş ein. Für manche sei der Besuch im Mobil ein Schlüsselereignis, für andere ein paar Stunden danach schon vergessen. „Wenn nur 10 bis 15 Prozent der Schüler:innen etwas aus den Workshops mitnehmen, ist das ein Erfolg.“ Allerdings reicht es nicht, wenn das Mobil vielleicht einmal im Jahr auftaucht. „Wie wäre es, wenn unser fahrendes Klassenzimmer ein modernes Pendant zur Sendung mit der Maus würde?“ Kooperationsanfragen aus der Schweiz und der Elfenbeinküste haben das Team bereits erreicht.
Ein Wahlspiel in der Kälte
Die Schulglocke schrillt. Auf dem leeren Pausenhof stehen die Kinder der 6b eng zusammengedrängt, wie eine Gruppe Pinguine. Sie zittern in der Herbstkälte, reiben die Hände aneinander, treten von einem Bein auf das andere. Vor ihnen eine Kiste mit gelben und grünen Schaumstoffbällen. „Jeder von euch bekommt jetzt einen Ball …“, sagt Karl Schweizer, „… solange die Musik spielt, könnt ihr miteinander tauschen. Verstanden?“ Er drückt auf Play, Sabrina Carpenters „Espresso“ schallt aus der Boombox.
Sofort rennen die Kinder los, werfen die Bälle hin und her, rätseln, was es wohl mit den Farben auf sich hat, warum es mehr gelbe als grüne gibt. „Stop“, ruft Schweizer, die Musik verstummt. „Die Gruppe mit den gelben Bällen kommt mal zu mir. Ihr dürft jetzt entscheiden, wo es auf Klassenfahrt hingeht.“ Die Kinder tuscheln, schreien dann „New York“. Die Gruppe mit grünen Bällen murrt, guckt genervt, einige stützen die Hände in die Hüfte. „Wie fühlen sich die anderen damit?“, fragt Schweizer. „Unfair!“, ruft ein Mädchen.
Der Wind wirbelt ein paar Blätter über den Asphalt, Sonnenstrahlen schimmern durch die gelb-braunen Baumkronen. Nächste Runde. Jetzt darf die Minderheit entscheiden, mit welchem Transportmittel die Klasse nach New York kommt. „Helikopter“, entscheiden die Kinder einstimmig. Runde drei. Eine einzige Person darf diesmal festlegen, was es in der Mensa zu essen gibt. Ihr Wunsch: Schnitzel mit Kartoffelsalat. Viele der Kinder scheinen unzufrieden. „Aber ich bin doch Vegetarierin“, flüstert ein Mädchen. Die Musik geht wieder los, letzte Runde: Die Klasse wählt zwei Kinder, die stellvertretend für alle entscheiden, welche Lehrkraft die Fahrt begleiten soll.
„Und, welche Abstimmungsform hat euch am besten gefallen?“, fragt Leder. Einige ziehen die Jacken enger um die Schultern, andere stecken die Hände in die Taschen, man sieht es in ihren Köpfen arbeiten. „Manchmal fühlt es sich blöd an, wenn andere für einen entscheiden“, sagt ein Mädchen vorsichtig. Ein Junge ruft: „Aber wenn alle mitreden dürfen, dauert es ewig.“ Einige Kinder nicken, andere protestieren, ein paar enthalten sich. „Demokratie bedeutet manchmal, dass wir viel Geduld haben müssen und dass es mal Streit gibt, bis wir uns einigen können“, sagt Leder.
Einige Kinder wirken nachdenklich, als sie aus dem Workshop entlassen werden, andere rennen zur Eingangstür, in Gedanken schon in der Boulderhalle oder im Gitarrenunterricht. „Manchmal ist es nicht der Moment selbst, der die Veränderung bringt, sondern das Nachwirken“, sagt Ateş. „Demokratie beginnt oft mit einem Gefühl.“ Vielleicht bleibt den Schüler:innen von diesem Tag nur das Lachen beim Bälle-Tauschen oder der innere Protest gegen den Schnitzel-Beschluss im Gedächtnis. Aber vielleicht erinnern sich manche an die Entscheidung mit den gelben und grünen Bällen. Und an das Gefühl, das sie hinterlassen hat.
Schulessen ist auch eine Frage der Mitbestimmung – und manchmal genauso umstritten wie große politische Entscheidungen.