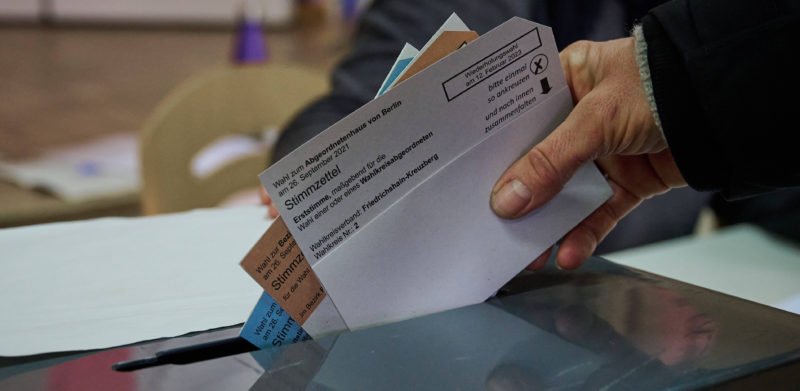Frankreich, Italien, England, Schweden – der Populismus blüht, die Demokratien des Westens scheinen zu wanken. Sie sagen: Das liegt zum guten Teil am Konservatismus. Wie das?
Thomas Biebricher: Die gemäßigten Kräfte in den konservativen Parteien verlieren seit etwa zehn Jahren an Zustimmung, die rechte Mitte verwaist. Dieses Vakuum können liberale oder linksliberale Parteien nicht füllen, meist stoßen Kräfte vom rechten Rand des politischen Spektrums in diese Lücke, wie in Frankreich, wo die Schwäche der konservativen Républicains das rechtsextreme Rassemblement Nationale gestärkt hat. Das ist ein Problem für liberale Demokratien, sie drohen aus dem Gleichgewicht zu geraten.
Wie zeigt sich denn diese Krise?
Zum einen in einem Bedeutungsverlust, manche konservativen Parteien schrumpfen gar zu Nischenexistenzen. Zum anderen in der Radikalisierung ehemals gemäßigter Konservativer. Wie die Republikaner:innen in den USA. In Großbritannien haben die Tories zwar im Unterhaus noch eine Mehrheit wie seit vierzig Jahren nicht, doch bei der nächsten Wahl wird sich das gravierend ändern. Denn die Partei ist völlig zerrissen und rutscht immer mehr zum rechten Rand. Die Vorzeichen des Abstiegs haben sich bei den Kommunalwahlen im Mai gezeigt: Die Tories haben massiv verloren.
Welche Ursachen gibt es dafür?
Ein ganzes Bündel, aber zwei stechen besonders ins Auge. Zum einen der Trend zur Personalisierung, der bei konservativen Parteien besonders ausgeprägt ist. Ein starker Kopf mit enger Verbindung zur Parteibasis steht an der Spitze. Das klingt partizipativ, ist aber das Gegenteil. Denn weil sich die Führung auf die Legitimation der Basis berufen kann, hat sie viel autoritäre Macht. Die Funktionär:innen, die über Jahre in der Partei hochgewachsen sind, haben nicht mehr viel zu sagen und entfallen als Korrektiv. So kann die Parteiführung die Position ihrer Partei viel leichter verschieben. In der italienischen Lega gibt Matteo Salvini den Ton an, die Forza Italia ist immer noch maßgeblich von Silvio Berlusconi geprägt. Und selbst Ex-Parteichefs wie Boris Johnson haben noch Jahre nach ihrem Abtritt großen Einfluss auf ihre Partei. Zum anderen beobachten wir im Konservatismus überall die Tendenz, sozioökonomische Konflikte kulturell auszutragen. Die Debatte um Einwanderung etwa wird als Frage des Lebensgefühls diskutiert.
Weil Konservative bei harten sozialpolitischen und wirtschaftlichen Themen immer weniger punkten können?
Genau, denn ihre Positionen auf diesen Feldern unterscheiden sich gar nicht mehr so klar von denen in Parteien links der Mitte. Die Sozialdemokratie und andere Linke sind wirtschaftspolitisch längst in die Mitte gerückt. In Frankreich und Italien haben sie ihre Länder erfolgreich in die Eurozone geführt. Sie als Pseudo-Kommunist:innen zu beschimpfen, überzeugt nicht mehr. Überall fehlen den Konservativen also die Feindbilder, die sie dringend zur Mobilisierung ihrer Wähler:innen brauchen. Also packen sie kulturpolitische Fragen auf den Tisch …
… Gendern, Transrechte, jede Menge Symbolpolitik …
… und wer hier Empörung inszeniert, bekommt viel Aufmerksamkeit und das heißt: potenziell neue Wähler:innen. Arbeiter:innenmilieus in Nordengland etwa, die seit Generationen Labour wählen, hätten Boris Johnson nie wegen seiner Finanzpolitik ihre Stimme gegeben. Doch der Slogan „What it means to be British“ hat sie gecatcht. Den Konservativen gelang es zu zeigen, dass die abgehobenen linksgrünen Labours eine selbstverliebte Wohlfühlelite sind, die die Arbeiter:innenklasse längst aus dem Auge verloren hat.
In Ihrem Buch sprechen Sie von einer Wiederbelebung der Feindbilder von 1968.
Es gibt bemerkenswerte viele Parallelen. 1968 gingen Student:innen für eine kritische Auseinandersetzung mit der Nazivergangenheit, eine offenere Gesellschaft und eine Reform der verstaubten Hochschulen auf die Straße. Die Konservativen haben diese Studierendenrevolution immer als Kulturkampf von links gedeutet. Sie attestierten den jugendlichen Akteur:innen eine grundsätzliche Infantilität und Lebensunfähigkeit. So ähnlich funktioniert die Kritik an der Woke-Bewegung jetzt auch. Die sind aus konservativer Sicht alle verführt von der linksliberalen akademischen Elite. Und genau wie 1968 wird die Kritik an der Wokeness und ihrem Aktivismus verschaltet mit Gefahr von terroristischen Auswüchsen. 1968 habe den Weg für den Linksterrorismus geebnet, jetzt drohe der Klimaterrorismus. Als autoriär gelten in dieser Sicht die Woke Warriors, die vor lauter Moral nicht mehr laufen können.
Aber was macht den Konservatismus im Kern aus? Es ist ja ein reichlich schwammiger Begriff.
Das eine ist der Wunsch, Dinge zu bewahren. Dahinter steht eine Vorstellung von guter, natürlicher Ordnung. Die heteronormative Familie mit zwei Kindern etwa. Dabei wird ihr diese Natürlichkeit nur zugeschrieben, es gibt schließlich keinen Grund, warum diese Lebensform natürlicher sein sollte als andere. Letztlich bleibt oft extrem vage und auch unter Konservativen umstritten, was genau bewahrt werden soll. In der Praxis entsteht das Bewahrenswerte oft in Abgrenzung zu anderen gesellschaftlichen Kräften, die etwas infrage stellen. Der andere Kern ist ein zutiefst antirevolutionäres Politikverständnis. Denn die große Tragik des Konservatismus heißt: Dinge lassen sich oft nicht bewahren …
… Wandel findet einfach statt …
… genau. Daher sagen Konservative: Wenn schon Wandel, dann auf der Basis des Bewährten, der Erfahrung, Schritt für Schritt. Nur so ließen sich unabsehbare Folgen verhindern. Dahinter steht die Idee eines fast organischen Wachstumsprozesses. Der englische Philosoph Michael Oakeshott vergleicht Konservative daher mit Gärtner:innen, die im Gegensatz zu Ingenieur:innen die Welt nicht als Material betrachten, das sie ihrem Willen unterordnen und beliebig bearbeiten können. Gärtner:innen begegnen der Welt mit Demut, sie begleiten und kultivieren mit Vorsicht.
Die Klimakrise lässt allerdings keine Zeit für Trippelschrittchen
Und doch bin ich überzeugt, dass der ökosoziale Umbau der Gesellschaft ohne die Konservativen überhaupt nicht möglich ist. Konservative sind entscheidend, damit der Wandel von der Mehrheit mitgetragen wird. Auch von jenen, die Angst vor ihm haben. Die Konservativen bestimmen, wie Diskussionen über Wandel ausgetragen werden, ob Positionen von rechts außen in die rechte Mitte rücken und damit legitimiert werden. Und Konservative wissen sehr wohl, dass es nicht reicht zu sagen: Wir bremsen alles ab. Dafür ist schon viel zu lange gebremst worden. Ein kluger Gärtner handelt vorausschauend. Konservative hätten schon lange darüber nachdenken müssen, wie es in den nächsten 10, 20 Jahren weitergehen soll, damit das Wasser im Garten nicht versiegt. Stattdessen haben sie sehr unkonservativ eines ihrer Kernanliegen selbst gefährdet – bewahren. Jetzt bleibt nichts, als unter Hochdruck einen Weg zu finden: Wollen wir aus der öffentliche Empörung über die Heizungspolitik der Regierung Profit ziehen oder eine konstruktive Rolle spielen?
Wie könnte die konkret aussehen?
Die Konservativen können durchaus Wandel. Das erste Umweltministerium Deutschlands hat die CSU in Bayern auf die Beine gestellt, CDU-Mann Klaus Töpfer war der zweite Bundesumweltminister der Bundesrepublik und hat Umwelt als Thema in die Union getragen. Jetzt gibt es die Klimaunion. Allerdings dürfen sie Konservative nicht als Feigenblatt nutzen, indem sie sagen: Guckt, wir haben selbst Ökos – und dann jeden ihrer Vorschläge in der Partei ausbremsen. Ja, ich glaube, der gemäßigte Konservatismus kann ein Motor für die Transformation sein, weil er konstruktiv mit Wandel umgeht.
Warum tut er das?
Weil das Wichtigste für ihn letztlich schlicht Stabilität ist. Wenn Konservative erkennen, dass sich eine Entwicklung nicht mehr bewahren lässt, akzeptieren sie diese nach einer gewissen Trauerarbeit doch: Lass uns nach vorn schauen und den neuen Status quo verteidigen. So haben sie mal ihren Frieden mit Liberalismus, Individualismus und Technologie gemacht, so arrangieren sie sich heute seufzend mit der Ehe für alle. Jetzt geht es eben um das Adoptionsrecht oder die In-vitro-Fertilisation für gleichgeschlechtliche Paare. Die Gesellschaft dadurch zu destabilisieren, dass man um Biegen und Brechen versucht, das Rad der Zeit zurückzudrehen, ist für gemäßigte Konservative ein noch größerer Horror als der Wandel selbst. Sie wollen unbedingt vermeiden, dass die Gesellschaft auseinanderfällt.
Im Gegensatz zu den Autoritären …
… die unbedingt destabilisieren wollen, weil sie überzeugt sind, dass der Status quo nicht mehr bewahrenswert ist, sondern völlig korrumpiert und deformiert von all den Neuerungen. Für sie bleibt nur: System zerstören und neu aufbauen.
Ohne die Wähler:innen auch inhaltlich zu überzeugen, wird der Konservatismus kaum überleben, oder?
Absolut, Konservative müssen Antworten auf zentrale Themen wie Klimakrise, Migrations- und Sozialpolitik geben. Dabei lässt sich verantwortungsbewusste Klimapolitik durchaus als urkonservatives Thema verstehen: Genau wie wir künftige Generationen nicht mit übermäßigen Schulden belasten dürfen, schulden wir ihnen den Erhalt einer lebenswerten Umwelt. Dafür müssen wir opferbereit sein, wir verteidigen damit die göttliche Schöpfung und erfüllen den bestehenden Verfassungsauftrag. Alles originär konservative Argumente. Konservative müssen nur den Mut haben, ihre Anhänger:innen daran zu erinnern, dass es diese Opferbereitschaft braucht, um ein guter Konservativer beziehungsweise eine gute Konservative zu sein. Schließlich ist für Konservative die individuelle Freiheit nicht das Wichtigste, sondern das Bewahren der Ordnung und der gesellschaftliche Zusammenhalt – das Band zwischen den Generationen.

Thomas Biebricher ist Heisenberg-Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Frankfurt. Seit Jahren forscht er zu politischen Strömungen wie Neoliberalismus oder Konservatismus. Im April erschien sein Buch “Mitte/Rechts: Die internationale Krise des Konservatismus” bei Suhrkamp.
Für eine vielfältige Gesellschaft benötigen wir einen gemäßigten Konservatismus.