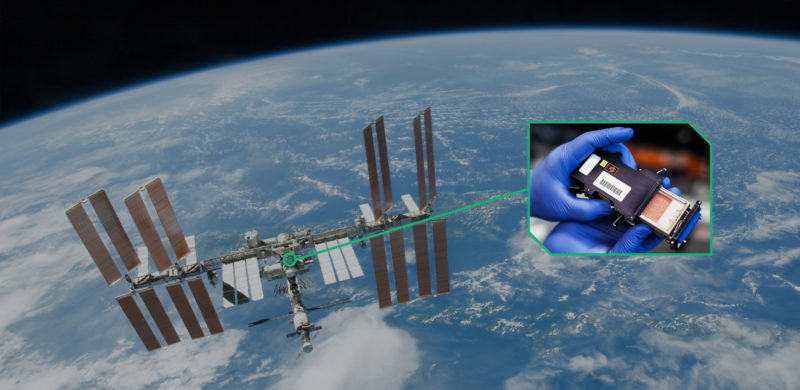Gedämpftes Tageslicht fällt durch die dichten Lamellen, dahinter muss ein Fenster sein. Es ist leise wie in einem Schallschutzraum. Ab und an das fast lautlose Aufsetzen von Gummisohlen auf den Bodenfliesen, Atmen, Rascheln von Mänteln. Manche Besucher:innen stecken kurz den Kopf in das Zimmer, andere bleiben zehn Minuten, andere dreißig, wenige eine Stunde. Dabei ist hier fast nichts. Wandteppich, weiße Wände, schwarze Stühle. Und eine Stille, die leicht in den Ohren sirrt.
Tür auf, und schon bellt die Stadt. Beats knallen über den Pariser Platz in Berlin, 15.000 Menschen sind zu einer Demo für Frauenrechte gekommen. Reisegruppen schieben sich an den Säulen des Brandenburger Tors vorbei, Tourleiter:innen rufen. Drei Mädels posen fürs Foto. Tor, Sonne, Himmelsblau – kreisch. Autos hupen, ein Hop-on-Hop-off-Bus schnauft, ein Martinshorn saust vorbei, „Kaufen Sie LED-Ballons!“, schreit ein Händler, die Hände voller blinkender Kugeln. Alltagslärm der Hauptstadt.
Wer aus dem Raum der Stille im Brandenburger Tor in die Stadt stolpert, merkt doppelt: Alles verdammt laut hier. So sieht das auch die Mehrheit der Deutschen: 80 Prozent fühlen sich nach einer repräsentativen Gesundheitsstudie der Universität Mainz von Lärm in ihrer Umgebung belästigt, vor allem Menschen in Städten. Besonders quält sie Verkehrslärm, 75 Prozent klagen darüber. Dabei sind Autos, U-Bahnen, Züge, Bagger in den vergangenen Jahren nach Expert:inneneinschätzungen um 12 Dezibel leiser geworden. Gesetzliche Auflagen wurden verschärft, die Obergrenzen für ihre Lautstärke gesenkt.
Das Problem: Es gibt mehr Lärmquellen denn je. Mehr Autos und Flieger, Busse und Bahnen, mehr Menschen, mehr Tech an allen Ecken und Enden. „Zudem hat die Geräuschempfindlichkeit zugenommen“, sagt André Fiebig, Professor für Psychoakustik an der Technischen Universität (TU) Berlin. „Eine Studie des Bundesumweltamtes zeigt: Was wir vor dreißig Jahren noch okay fanden, erscheint uns heute unerträglich.“ Auch weil die Menschen genauer hinhören – „Lärmbewusstsein“ nennt das Fiebig. Denn längst wissen wir, dass Lärm krank machen kann. Erst recht, wenn er chronisch wird. Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen können die Folge sein. Wer etwa im Schlaf über längere Zeit mit Flugzeuggeräuschen beschallt wird, bekommt steifere Blutgefäße, das haben Mediziner:innen der Universität Mainz herausgefunden. Kein Wunder, dass inzwischen 62 Prozent der Menschen laut einer Untersuchung der Techniker Krankenkasse ihr Leben stressiger finden als noch vor 15 Jahren.
Wann wird ein Geräusch zu Lärm? Die Literaturkritikerin Sieglinde Geisel hat dafür in ihrem Buch Nur im Weltraum ist es wirklich still tief in die Kulturgeschichte geschaut. „Das Wort Lärm kommt von dem italienischen Schlachtruf all’arme, ein plötzliches Geräusch also, das aufschrecken soll: Greift zu den Waffen!“ Lärm als Warnung. Welche Geräusche und welcher Lautstärkepegel in einer Gesellschaft negativ empfunden werden, ist kulturell unterschiedlich. In Ländern, in denen ein Großteil des Zusammenlebens draußen stattfindet, ist der Pegel meist höher, das laute Gewirr von Geräuschen gehört zum Leben. Geisel: „Dort wird die Stille eher als bedrohlich empfunden, in der Nacht etwa – es fehlt das Gefühl von sozialer Gemeinschaft.“ Und nur wenige Sprachen unterscheiden wie das Deutsche zwischen Geräusch und Lärm. Im Englischen, Französischen und Italienischen zum Beispiel gibt es dafür nur einen gemeinsamen Begriff: noise, bruit, rumore. „Lärm ist immer auch eine Frage von Macht“, sagt Geisel. „Trommeln auf einer Demo, Jugendliche, die im Park die Boombox aufdrehen, die Kirche, die ihre Glocken läutet.“ Wer darf Krach machen, wer bekommt Ärger, wer erobert den akustischen Raum?
Lärm ist subjektiv
Seit den 1920er-Jahren lässt sich Lautstärke präzise messen, in Dezibel, einer Einheit für Schalldruck. Erste Normen und Obergrenzen wurden festgelegt. Doch längst ist klar: Lärm ist nicht nur eine Frage der Dezibelstärke. Was Menschen unabhängig von der Kultur als störend empfinden, ist höchst subjektiv und kontextabhängig. Ein Wasserfall kann so laut sein wie eine Hauptverkehrsstraße, doch die meisten erleben sein Rauschen als viel leiser, weil sie ihn mit Natur und Entspannung verbinden. Wer ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbar:innen hat, wird ihr Trampeln vermutlich anders bewerten als jemand, der mit ihnen im Klinsch liegt. Kulturforscherin Geisel ist noch ein Bauleiter in Erinnerung, für den das Donnern der Bagger alles andere als Lärm war – „sondern der wohltuende Sound von Aufschwung und Wohlstand“.
Psychoakustiker André Fiebig beschäftigt sich mit den psychologischen Mechanismen, die ein Geräusch zu einem „unerwünschten Hörschall“ machen, wie Lärm im Sprech des Deutschen Instituts für Normung heißt. „Wie Menschen Geräusche bewerten, hängt auch davon ab: Können sie einordnen, woher sie kommen? Sind sie selbst Verursacher:in? Sind sie Geräuschen ausgeliefert?“ Was für den Motorradfahrer ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer ist, wird für Menschen am Straßenrand schnell zum Horror. Dem Jaulen des Motors können sie nicht entweichen. Wie Hunderten anderen Geräuschen im Stadtwirrwar.
Was tun? „Wir sollten die Geräuschlandschaft in der Umwelt genauso gestalten wie ihre Architektur“, schlägt Fiebig vor. Soundscape-Design nennt sich das.
Entstanden ist die Idee in den 1970er-Jahren in den Musikwissenschaften, seit den 1990ern gewinnt das Forschungsfeld in der Umweltakustik an Bedeutung. Soundscape is…
Inmitten des Lärms gibt es sie: Rückzugsorte der Stille für alle, die dem hektischen Geräuschpegel in Stadt, Medien und Alltag entfliehen wollen.