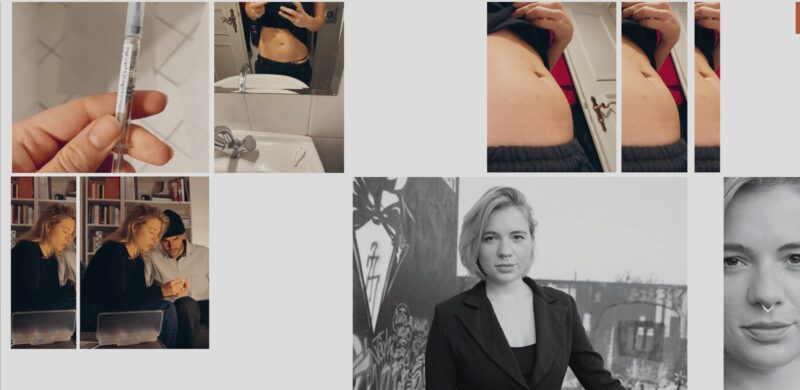Ein Nachmittag im kalifornischen Santa Cruz, Fundraising für das Homeless Garden Project, eine Biofarm zur Ausbildung obdachloser Menschen. Zwischen grünen Pflanzenbeeten und weiß gedeckten Dinnertischen steht ein Mann und hält eine Ansprache. Seine Botschaft: Wir machen uns etwas vor. Es ist zu spät, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Lasst uns endlich ehrlich sprechen.
Der Mann heißt Jonathan Franzen, ist preisgekrönter US-Bestsellerautor, und seine Rede vor vier Jahren in jenem grünen kalifornischen Garten wurde als Klimaessay „Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen?“ (Rowohlt 2020) berühmt. Franzen gehört zu den vehementesten Mahnenden für einen anderen Umgang mit der Klimakrise. Über Jahrzehnte das Dauernarrativ Es-ist-fünf-vor-zwölf zu bedienen, sei bestenfalls gut gemeint, sagte er im Dezember 2023 im Interview mit dem Magazin Futur Zwei. Doch die Menschen fühlten sich nicht ernst genommen, „es macht sie erst skeptisch, dann zynisch“. Legt also die Karten auf den Tisch. Aus Respekt. Und dann?
Die Fakten sind in der Tat wenig erheiternd. Rechnet man die Oberflächen der Ozeane heraus, ist die 1,5-Grad-Grenze in einigen Regionen der Erde laut Weltklimarat IPCC schon überschritten. Zwischen 2030 und 2035 wird das vermutlich überall der Fall sein, heißt es im Synthesebericht vom Oktober 2023. Und die Entwicklung schreitet schneller voran, als bisher angenommen, Ökosysteme reagieren noch sensibler auf die Erderwärmung, als gedacht.
Bilanz der Expert:innen auf dem 13. Extremwetterkongress 2023: Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr realistisch, viele Veränderungen des Klimas sind unumkehrbar. Damit wenigstens grobe Anpassungen gelingen, müssen die Treibhausgasemissionen schon bis 2030 um mehr als die Hälfte sinken. Müssen wir also mehr über Katastrophen reden, wie Jonathan Franzen vorschlägt? Oder brauchen wir stattdessen eher inspirierende Visionen, konstruktiv-hoffnungsvolle Zukunftsbilder, die uns klar machen, wie das Leben in einer klimagerechten Gesellschaft überhaupt aussehen könnte, wofür es sich lohnt, einschneidende Veränderungen in Kauf zu nehmen? Und wenn ja, wie können wir sie alle zusammen entwickeln?
Die Klimakrise wird oft verdrängt
An Informationen über die Klimakrise fehlt es zumindest nicht. Und repräsentative Befragungen zeigen, dass sich hierzulande 80 Prozent der Menschen der Bedeutung der Klimakrise grundsätzlich bewusst sind. Allerdings wird das Thema immer wieder von anderen konflikträchtigen Fragen wie Migration, Corona oder Russlands Krieg gegen die Ukraine verdrängt. Beispiel ZDF Politbarometer. Dort werden jeden Monat Menschen gefragt, was für sie derzeit das wichtigste Problem ist. Vor zehn Jahren landete die Klimakrise weit hinten. Als Fridays for Future 2019 die Debatte über Klimaveränderungen und Kipppunkte auf die Straße brachte, wurde die Erderwärmung für 60 Prozent zur größten Sorge. Inzwischen bereitet sie wieder nur noch 20 Prozent schlaflose Nächte. „Menschen können sich nicht über alles gleich viel Sorgen machen“, sagt Julian Bleh, Sozialpsychologe an der Universität Leipzig. „Finite Pool of Worry“, heißt das in der Wissenschaft, irgendwann ist das Fass voll, psychisch sind mehr Sorgen nicht verarbeitbar, es wird ausgemistet. „Was für den eigenen Alltag nicht akut bedrohlich erscheint und kein unmittelbares Handeln erzwingt, fliegt zuerst raus“, so Bleh. Systemische Risiken werden daher chronisch unterschätzt.
Eine Forscher:innengruppe um Johan Rockström und Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hält daher einen Reality-Check für überfällig. Im Fachjournal PNAS forderten sie bereits Mitte 2022, die Bad-to-Worst-Case-Szenarien stärker in den Blick zu nehmen, zum Beispiel in einem IPCC-Sonderbericht. Bislang konzentrieren sich die IPCC-Reports vor allem auf Szenarien mit Temperaturanstiegen bis zu zwei Grad. Aber welche Folgen hätte eine Erhitzung der Welt auf drei oder vier Grad für die Menschen in unterschiedlichen Regionen? Was würde das für die Umwelt, für den Alltag, die Stabilität der Gesellschaften bedeuten? Fazit der Autor:innen: Bleiben wir blind gegenüber Worst-Case-Szenarien, ist das bestenfalls naives Risikomanagement, im schlimmsten Fall aber unterlaufen uns tödliche Fehler.
Katastrophenerzählungen sind Philipp Schrögels Alltag. Am Käte Hamburger Kolleg für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien (CAPAS) der Universität Heidelberg untersucht er ihre Wirkung auf Menschen: Was bewegen sie und welche Rolle sollten sie in der Klimakommunikation spielen? Trotz der Schwermütigkeit seines Fachgebiets grüßt Schrögel mit heiterer Stimme am Telefon. „Die Beschäftigung mit Worst-Case-Szenarien hilft zum einen dabei, seine Ängste anzunehmen und zu verarbeiten“, so Schrögel. „Zum anderen bringt es nichts, die Augen zu verschließen, wie die Menschen im Blockbuster Don’ t Look Up, die einen auf die Erde zurasenden Meteoriten ignorieren, bis er sie zerstört“, so Schrögel. „Wir brauchen ein angemessenes Problembewusstsein und eine Kultur, in der ernsthaft über die zentralen Probleme gesprochen wird. Nur wenn wir uns mehr mit fundierten katastrophalen Szenarien beschäftigen, die weniger wahrscheinlich, aber möglich sind, bekommen wir ein realistisches
Gesamtbild.“
Allerdings: Wenn Untergangsszenarien zum Ritual verkommen, wenn Climate-Endgame-Darstellungen zur Dauerbeschallung werden, lähmen sie – eh alles aussichtslos – oder befeuern die Verdrängung – wird schon gut gehen. Dennoch: Sind Worst-Case-Szenarien eindringlich, konkret und anschaulich verpackt, zum Beispiel in Daily Soaps oder Filmen, setzen sie sich leichter in der Aufmerksamkeitsökonomie durch und können das Bewusstsein schärfen, so Schrögel.
Das belegte schon Anfang der 2000erJahre eine Wirkungsstudie zum Klimaschocker The Day After Tomorrow unter Zuschauenden in Deutschland, den USA, Großbritannien und Japan. Nur knapp 10 Prozent der Befragten nahmen die Botschaft „Wir können ohnehin nichts tun“ mit nach Hause, 82 Prozent kamen zu dem Schluss: „Wir müssen die Klimakrise unbedingt aufhalten“. Fazit der Forschenden: Der Film hat Menschen sensibilisiert, die sich ansonsten für das Thema nicht oder kaum interessieren. Schrögel: „Popkulturelle Darstellungen können tatsächlich die Wahrnehmung verändern und haben dazu beigetragen, dass sich Normen verschieben.“ Klimaleugnen ist heute wenig mehr als ein Randphänomen. Damit Worst-Case-Szenarien nicht nur das Bewusstsein ändern, sondern auch zum Handeln motivieren, braucht es jedoch noch eine wichtige Zutat: „Sie müssen mit konkreten, positiven Lösungsideen verbunden werden“, sagt Schrögel. Kurz, mit Möglichkeiten zum Anpacken und konstruktiven Zukunftsbildern oder: Utopien. Aber an ihnen fehlt es massiv. Von einer „Krise der Imagination“ spricht Sozialpsychologe Bleh. So hat 2023 eine repräsentative Befragung der NGO Climate Outreach gezeigt: Die meisten Menschen in Deutschland können sich überhaupt nicht vorstellen, wie ihr Leben in einer sozial und ökologisch gerechten Gesellschaft aussähe. „Wir reden ständig über Maßnahmen, Heizungsgesetz dort, CO2-Preis hier, aber beschäftigen uns gar nicht damit: Wo genau wollen wir damit hin?“, so Bleh. „Und weil uns diese Vorstellungskraft fehlt, ist die Bereitschaft gering, sich auf Veränderungen einzulassen. Stattdessen dominieren Hilflosigkeit, Enttäuschung, Wut.“
Klima-Utopien: man kann lernen, sie zu imaginieren
Das Gute ist: Utopisches Denken kann man lernen. Bleh lässt es Menschen in sogenannten Visionsexperimenten ausprobieren: Repräsentativ ausgewählte Teilnehmende denken darüber nach, wie für sie eine ideale nachhaltige Gesellschaft aussehen könnte. Ein typischer Tag im Jahr 2030 etwa. Wie wollen wir zusammenleben, arbeiten, essen, uns durch die Welt bewegen? „Es geht darum, locker Ideen für eine wünschenswerte Gesellschaft zu spinnen.“ Die Wünsche der einzelnen Teilnehmenden sind dabei unabhängig von Herkunft, Bildungsgrad und Geschlecht meist bemerkenswert ähnlich: Sie möchten einen respektvolleren Umgang mit der Umwelt, weniger Ungleichheit, weniger Hierarchien, weniger Konsum, mehr Solidarität und Akzeptanz von Unterschiedlichkeit.
Bemerkenswert ist der Effekt solcher Übungen, Bleh hat ihn untersucht: Die Teilnehmenden der Visionen-Runden können sich anschließend gesellschaftliche Veränderungen besser vorstellen und halten sie sogar für realistischer. Das freie Gedankenspiel hilft, sich vom Status quo zu lösen. Wer bislang Wirtschaft nur unter dem Aspekt Wertschöpfung betrachtet hat, entwickelt also durch die Beschäftigung mit Utopien leichter eine bessere Vorstellung, wie Wirtschaft mit geringem Ressourcenverbrauch und ohne Abfall konkretaussehen könnte – und wie sie sich im Alltag anfühlt. Und sie sind durch die Visionsarbeit motiviert, selbst etwas zu tun. Sich in Initiativen vor Ort zu engagieren, auf die Straße zu gehen und der Politik Druck zu machen. Bleh: „Ob sie es tatsächlich tun, wissen wir allerdings nicht.“
Utopien sind also ein Kompass für die Gesellschaft und zentraler Motor für Veränderung, ohne die jedes dystopisch vermittelte Problemverständnis verpufft. „Wir brauchen eine neue politische Kultur, orientiert an gemeinsam entwickelten Visionen“, sagt Bleh. „Dann werden auch die einzelnen Maßnahmen, die zu diesen Veränderungen führen, eher mitgetragen – bis die Unterstützung der Veränderung Standard wird und eine neue gesellschaftliche Norm entsteht.“ Damit eine Utopie in großem Stil zu kollektivem Handeln führt, hat die sozialpsychologische Forschung weitere Motoren ausgemacht: Wenn sich Menschen als Teil einer Gruppe betrachten, die für Veränderung steht, wenn dieser Wandel ihren Werten entspricht und sie ihn als sinnstiftend erleben und erfahren, dass sie gemeinsam mit den anderen etwas bewirken können, werden sie eher aktiv. Aber können uns positive Utopien nicht auch falsche Hoffnungen machen?
Die Augsburger Hoffnungsphilosophin Claudia Blöser schüttelt den Kopf. „Nur, wenn wir uns Zukünfte einreden, die gegen jede Evidenz sprechen.“ Wir müssen nichts ändern, neue Technologien werden es schon richten, das CO2 aus der Luft saugen. Eine solche Hoffnung lähmt, denn sie fokussiert auf etwas, das die Probleme lösen soll, ohne selbst handeln zu müssen. Dabei sei es gerade die Hoffnung, die Kraft entfalten kann: Denn während eine optimistische Haltung Entwicklungen für wahrscheinlich hält, stößt Hoffnung das Fenster zum Möglichen auf – es mag unwahrscheinlich sein, aber es ist machbar. Es lohnt sich also zu handeln, die Ritzen lebenswerten Lebens ausfindig zu machen, auch wenn die Erde glüht.
Ohne die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu über- oder zu unterschätzen. Um diese Ritzen aufzustöbern, brauchen wir nicht den einen utopischen Wurf. Es geht vielmehr darum, viele Zukünfte zu entwickeln, „kleine, handliche Hoffnungen wie wir leben und handeln können“, sagt Blöser. Lokal, gemeinsam, pragmatisch. Denn gerade die „Konkreten Utopien“, wie sie der Philosoph Ernst Bloch nennt, haben das Zeug dazu, ein Feuer der Veränderung zu entfachen – weil sie ausgehend von unserem Status quo Alternativen denken, anstatt allzu weit in eine unbestimmte Ferne zu fantasieren.
Wir haben Expert:innen befragt und Studien gewälzt – wie könnte sich die Welt entwickeln in den nächsten zwanzig Jahren? Was ist denkbar, was ist möglich? Dann haben wir die Kraft der Imagination spielen lassen und Zukünfte gebaut. Konstruktiv, voller Freude, einmal auch warnend vor einem Bad-Case-Szenario. Denn wir brauchen beides: Die fundierte Dystopie, die uns Dampf macht und jenen ehrlichen Blick eröffnet, von dem Jonathan Franzen spricht. Vor allem aber die vielen kleinen beflügelnden Utopien, die uns den Weg weisen in eine Gesellschaft, zu der wir hinwollen in einer klimagerechten Zukunft. Wir müssen nur gemeinsam dafür kämpfen. Vorhang auf für unsere Welt 2040.
Mut zu Pink: in unserem neuen Heft stellen wir uns einen klimagerechten Alltag 2040 vor