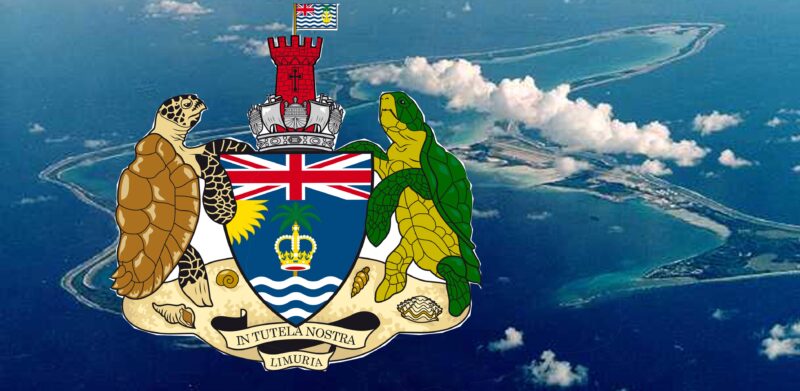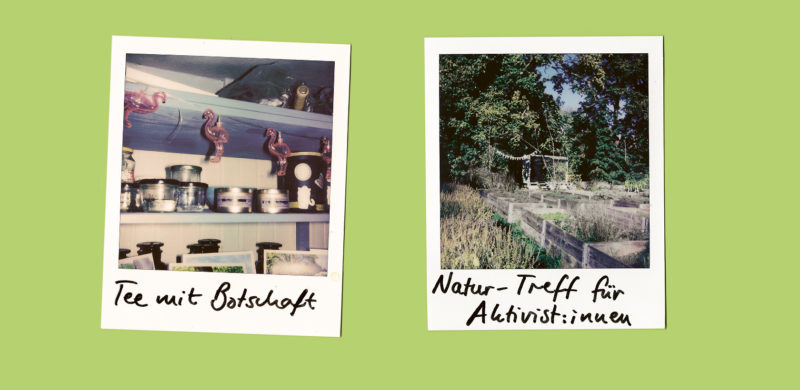Eine Holzbrücke führt über eine Senke nach Char Pouli, einem Dorf, in dem sich Wellblechhütten rund um Moschee und Marktplatz gruppieren. Durch die Lücke einer Wellblechmauer schlüpft man an einem Januartag 2024 in einen Hof, durch den eine Henne mit ihren Küken eilt. Jhorna Khatun tritt aus ihrem Haus heraus auf den Erdboden, ihr rotes Gewand setzt einen farblichen Akzent. Die Mittdreißigerin lässt sich auf einem Plastikstuhl nieder und zieht sich scheu ein Tuch über den Mund. Khatun liebt ihren Ort im Herzen Bangladeschs. Sie arbeitet dort als Näherin, kennt ihre Nachbar:innen, hat Verwandte. Sie will bleiben, unbedingt. Das Problem: Ihr Heimatdorf verschwindet, sukzessive. Und Khatun muss immer weiter zurückweichen.
Khatun lebt am Jamuna, einem Fluss, der sich 240 Kilometer durchs bengalische Tiefland wälzt und den Brahmaputra mit dem Ganges verbindet. Seit einiger Zeit geschieht Merkwürdiges mit ihm: Er dehnt sich immer weiter aus. An manchen Stellen ist er inzwischen so breit, dass von einem Ufer das andere nicht mehr zu sehen ist. Von Jahr zu Jahr frisst er sich tiefer ins Land. Dabei verschlingt er Tausende Hektar Uferflächen und reißt das Zuhause Zehntausender Menschen mit sich. Wie ein hungriges Tier.

Einst hat die Familie von Khatun viel Land besessen, auf dem sie Reis und Linsen anpflanzte. Neunmal musste ihr Vater das Haus abbauen und weiter landeinwärts versetzen. 5.000 Quadratmeter, ein halbes Hektar Land und eine Kuh habe der Fluss ihnen genommen, erzählt sie.Neben ihr haben sich andere Frauen und Kinder gruppiert, mehr als ein Dutzend, und im Haus müssen noch weitere zuhören, denn unterm Wellblech lugt eine ganze Reihe nackter Zehen hervor. Auch nachdem sie geheiratet hatte und mit ihrem Mann in ein eigenes Haus gezogen war, kam der Fluss gefährlich nahe. Sie zogen aufs Grundstück der Schwägerin. Eines Morgens sagte jemand, dass seltsame Geräusche vom Ufer kämen. Khatun rannte hin und sah, wie Uferstücke wegbrachen und unter Getöse ins Wasser klatschten. Ihr Land. Ihre Bäume, Mango- und Jackfruitbäume, die sie gepflanzt und gehegt hatte. Sie trieb die Kühe weg vom Abgrund und sah zu, wie sich der Riss vergrößerte und der unterspülte Boden wegsackte.

Man könnte annehmen, dass sie jetzt nur noch fortwill. Aber das Gegenteil ist richtig.
Reist man am Jamuna entlang, begegnet einem das immer wieder: Der Jamuna raubt den Menschen alles – und doch wollen sie sich nicht von ihm trennen. Sie setzen ihre Wellblechhütten ein paar Meter um, wenn ihr Land erodiert ist, oder ziehen weiter hinein ins Dorf, seltener in den nächsten Ort und noch seltener in die nächste Stadt. Schon gar nicht ins Ausland. Es ist also keineswegs so, wie es in der aktuellen Migrationsdebatte hierzulande oft vermittelt wird: dass sich die Menschen in den Wirren des Klimawandels rasch aufmachen und in Scharen in den reichen Norden fliehen.
Das ist das Ergebnis eines einzigartigen Langzeitprojekts der ETH Zürich. Die Wissenschaftler:innen wollten mit ihm herausfinden, was Klimamigration bedeutet. Normalerweise laufen Studien so ab: Irgendwo auf der Welt erodieren die Flussufer, versalzen die Böden oder verdorren die Landstriche – woraufhin Migrationsforscher:innen dorthin reisen und nach den Menschen suchen, die bereits geflohen sind. Doch das sind nur Momentaufnahmen. Die Klimakrise aber ist ein Langzeitphänomen. Auch ist nicht klar, ob die Geflohenen tatsächlich wegen des Klimawandels umgezogen sind oder aus wirtschaftlichen Gründen. Dazu braucht es eine Langzeitstudie.
Deshalb entschied sich das Team um Vally Koubi, Lukas Rudolph und Jan Freihardt für Bangladesch, genauer: den Jamuna. In Südasien führt die Klimaerwärmung dazu, dass die Gletscher im Himalaya abschmelzen, der Monsunregen an Kraft gewinnt und der Meeresspiegel steigt. Letzteres staut das Flusswasser vom Golf von Bengalen bis Hunderte Kilometer ins leicht abfallende Land zurück, was den Abtransport der Sedimente aus den Bergen erschwert. Es bilden sich Sandbarrieren im Fluss. Prallen die Wassermassen aus der Gegenrichtung darauf, krachen sie gegen die Uferbänke. Deshalb brechen in fast jeder Monsunsaison sandig-tonige Uferstellen weg. Wo genau, lässt sich nie im Voraus sagen.

Die ETH-Forschenden wählten 2.200 Menschen entlang des Flusses aus. Auf Satellitenkarten können sie nachverfolgen, wer nach einer Monsunsais…
Wenn sich der Fluss ins Land gräbt: Haus an der Abbruchkante des Jamuna