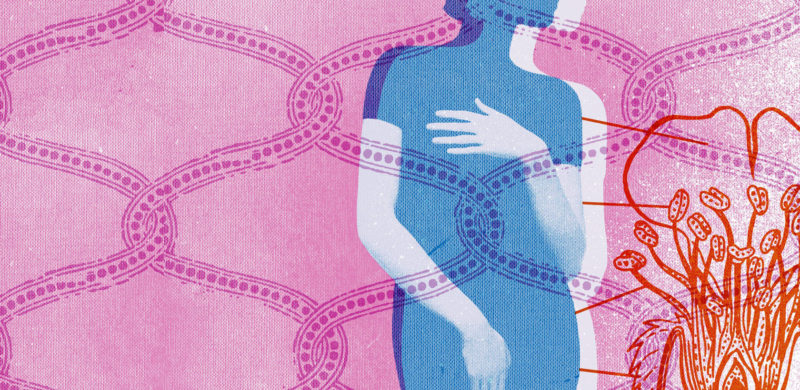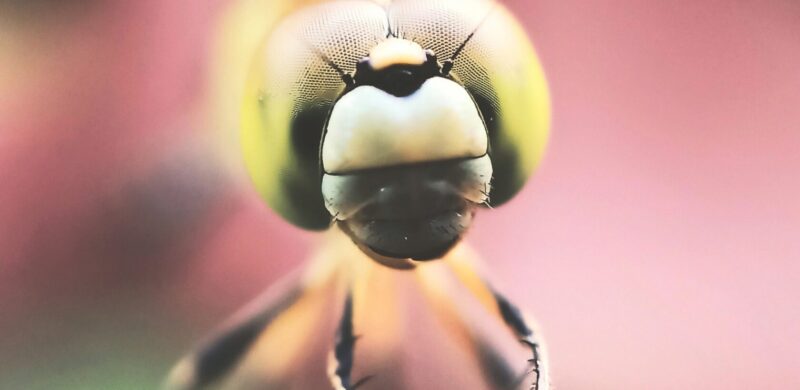Privatjets, Pools, Häuser an allen Ecken der Welt – das reichste ein Prozent der Welt pustet nach Berechnungen des World Inequality Lab der Paris School of Economics 100 Tonnen CO2 pro Jahr in die Luft, der globale Durchschnitt liegt bei 6 Tonnen. In Deutschland verbraucht das Top-1-Prozent 35-mal so viel wie das ärmste Drittel der Bevölkerung. Sollten wir Reiche extra zur Kasse bitten?
Stefan Bach: Das kann man machen. Denkbar wäre zum Beispiel ein Klimasoli. Wer in Deutschland viel verdient, könnte zeitlich befristet eine Sondersteuer zahlen. Die reichsten 8 Prozent der Steuerzahlenden, das sind etwa 4 Prozent der Bevölkerung mit einem Jahreseinkommen ab 85.000 Euro brutto, zahlen bis heute einen Solidaritätsbeitrag für die östlichen Bundesländer. Den könnten wir umwidmen und zu einem Klimasoli machen. Zumindest für die Bestverdienenden ab einem Jahresverdienst von 130.000 Euro. Das wäre praktisch eine Erhöhung der Spitzensteuersätze.
Sie haben ausgerechnet, was das bringen würde.
Bach: Derzeit spült der Soli gut 12 Milliarden Euro im Jahr in die Staatskasse. Er basiert auf einem Steuersatz von 5,5 Prozent, man könnte das auf 7 oder 10 Prozent erhöhen, das gäbe Mehreinnahmen von 3 bis 9 Milliarden Euro. Das ließe sich schnell, unbürokratisch und am besten zeitlich befristet umsetzen.
Um zum Beispiel in erneuerbare Energien oder öffentlichen Nahverkehr zu investieren?
Bach: Die Steuererhöhung selbst bringt nur wenig für den Klimaschutz, da die Betroffenen ihren Verbrauch dadurch voraussichtlich nicht sehr einschränken werden. Natürlich kann man mit dem Geld Klimaschutzmaßnahmen fördern. Vor allem verteilungspolitisch ist es sinnvoll, Hochverdienende stärker zur Kasse zu bitten.
Herr Alsleben, was halten Sie davon?
Thorsten Alsleben: Das leuchtet mir nicht ein. Wir haben doch längst eine massive Umverteilung. Viele Klimaschutzmaßnahmen und Förderprogramme – zum Beispiel zur Gebäudesanierung – werden aus Steuergeldern finanziert. Das einkommensreichste Prozent zahlt mehr als 24 Prozent der Steuern. Von den oberen 50 Prozent kommen etwa 94 Prozent der gesamten Lohn- und Einkommensteuer. Sie finanzieren also auch zu 94 Prozent das Förderprogramm für Gebäudesanierung. Ich halte es für falsch, Steuern für den Klimaschutz zu erhöhen. Deutschland ist jetzt schon Hochsteuerland, sowohl bei den Unternehmens- wie auch bei den Lohn- und Einkommenssteuern. Und bei den Spitzenverdienern werden fast 50 Prozent fällig. Wenn wir da noch einen Klimasoli drauflegen, grenzt das an Enteignung. Innovative Unternehmen im Land zu halten oder hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, wird aussichtslos.
Bach: Ja, wir haben relativ hohe Belastungen in unserem System. Aber ist es deshalb auch gerecht? Seit Jahrzehnten werden wohlhabende Menschen entlastet, obwohl ihre Einkommen und Vermögen stärker steigen als bei den Normalbürger:innen. Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen sind gesunken.
Alsleben: Aber wenn wir Investoren nach Deutschland holen wollen, dürfen wir sie nicht noch stärker mit hohen Steuern abschrecken. Die Direktinvestitionen im ersten Halbjahr 2023 sind schon eingebrochen, es fehlen Fachkräfte, die wir – gerade für die Transformation – dringend benötigen. Wenn sie 100.000 Euro verdienen und dann geht die Hälfte für Steuern und Sozialabgaben drauf, werden sie niemals kommen. Reiche stärker zu belasten, mag das Gerechtigkeitsgefühl einiger Menschen befriedigen. Unter dem Strich würde es uns allen schaden.
Bach: Das ist richtig, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Deutschland sollten wir vorsichtig sein mit zusätzlichen Belastungen, vor allem bei Unternehmen. Aber auf Dauer geht da mehr, etwa bei hohen Erbschaften oder Immobilien, wo es große Steuerprivilegien gibt.
Finden Sie also nicht, dass die Verantwortung der Reichen für die Klimakrise zu wenig finanziell berücksichtigt wird, Herr Alsleben?
Alsleben: Welche Reichen meinen Sie? Wenn irgendwelche Ölscheichs mit Privatjets und Jachten unterwegs sind, da bin ich auch mit Verboten dabei. Leider haben wir darauf keinen Einfluss. Einfluss haben wir nur auf die Reichen in Deutschland. Eben zum Beispiel über die Lohn- und Einkommensteuer. Den Hebel nutzen wir ausreichend. Um die Klimakrise effektiv und sozial gerecht zu lösen, halte ich die CO2-Bepreisung für ideal. Wir müssen den Schaden bepreisen, der durch CO2 verursacht wird.
Wie genau?
Alsleben: Über einen hohen CO2-Preis und einen weiteren Ausbau des Zertifikatehandels können wir umweltschädliches Verhalten für alle teurer machen und damit Reiche anteilig stärker zur Kasse bitten. Denn wenn Reiche 35-mal so viel verbrauchen wie der Durchschnitt, zahlen sie natürlich auch 35-mal so viel ein. Diese CO2-Bepreisung sollten wir konsequent auf alle Bereiche ausdehnen. Sodass jede Tonne CO2 in jedem Sektor gleich viel kostet und der Preis Jahr für Jahr steigt, weil die Menge an Zertifikaten sinkt.
Bach: Natürlich zahlen die Reichen beim CO2-Preis mehr als die Armen, weil sie mehr verbrauchen. Aber relativ zum hohen Einkommen macht das bei ihnen viel weniger aus. Daher können sie sich einen satten CO2-Preis locker leisten. Warum also sollten sie nicht so weitermachen wie bisher? Umgekehrt bei den Armen: Sie verbrauchen zwar wenig, aber bei ihrem geringen Einkommen spüren sie alle Zusatzkosten sof…
Stefan Bach (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) und Thorsten Alsleben (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft)