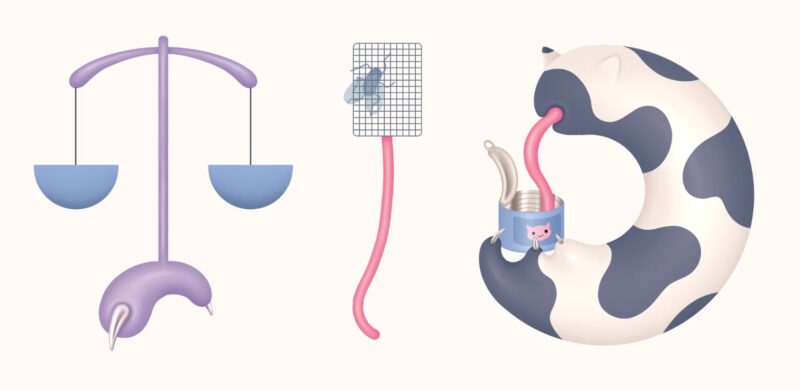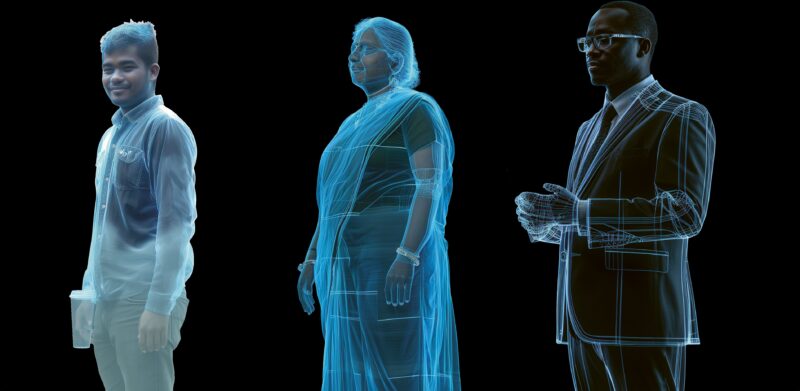Am schönsten ist die Arktis im Winter. Wie damals, als die Polarstern ein ganzes Jahr lang unterwegs war. In der arktischen Nacht schnappte sich Marcel Nicolaus dann manchmal seine Ski und lief über das weite Eis, zwei, drei Kilometer weg vom Schiff. Plötzlich war da nichts als Ruhe, taghell schimmerte das Meereis im Licht des Mondes. Krachend trocken die Winterkälte, minus 20 Grad, frisch und klar wie Kristalle in einem Glas. Nicolaus stand einfach nur da, minutenlang. „Aber normalerweise geht es leider im Sommer auf Forschungsfahrt in den Norden, da ist es 24 Stunden Tag, ideal zum Arbeiten.“ Dann schiebt sich der Eisbrecher des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) durch eine Nebelwand über das Meer. Es ist um die 0 Grad, die Oberfläche des Meereises nass, die feuchte Luft kondensiert und überzieht die Arktis mit einem dichten, grauen Weiß. Nur an jedem zehnten Tag reißt der Himmel auf – dann werden die Fotos gemacht, die um die Welt gehen: Forschungsfieber Polarexpedition.

Seit Ende der 1990er-Jahre ist der Meereisphysiker Marcel Nicolaus dabei. Sein Thema: Wie verändert sich das Meereis, was entscheidet darüber, ob und wie viel es schmilzt? Wie ist der Energieaustausch zwischen Eis und Atmosphäre, welche Rollen spielen Licht, Ozean, Temperatur und Salzgehalt des Wassers? Und was heißt das für das Klima, das Ökosystem, den Menschen?
Romantisch wie zu Zeiten des norwegischen Polarpioniers Fridjof Nansen, der Nicolaus in Schulzeiten faszinierte, ist an so einer Expedition nur noch wenig. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich Nansen mit nichts als einem Kompass und der vagen Vermutung aufgemacht, dass die Bewegung des Meereises ein Schiff von Sibirien über den Nordpol nach Grönland tragen müsste. Die Männer schliefen in schweren Zelten, ihre schneenassen Wolljacken trockneten nachts auf der Haut. Heute tragen Forscher:innen Hightech-Anzüge, schlafen in beheizten Kabinen, sogar eine Sauna gibt es im Schiffsbauch. Sie haben Handys in der Tasche, streamen Netflix, jeder Meter der Reise wird von der AWI-Zentrale in Bremerhaven per Satellit verfolgt. Zur Sicherheit.
Wenn sich die Polarstern mit 40, 50 internationalen Wissenschaftler:innen an Bord gen Norden aufmacht, ist der Druck des Eises manchmal so gewaltig, dass selbst der Motor des Eisbrechers nicht dagegen ankommt. Nicolaus: „Es bleibt nichts als Warten, bis sich die Gezeiten ändern und der Druck nachlässt.“ Die Reise geht von Scholle zu Scholle, bei jedem Halt wird eine Feldstation aufgebaut. Mit einer großen Bohrmaschine dreht Nicolaus dann ein Loch ins Eis, viele Stunden dauert das oft, lässt an einem Kabel einen Tauchroboter mit Sensoren und Kameras unter das zwei Meter dicke Eis gleiten, mal 20, mal 100 Meter tief, befestigt ihn oberirdisch an einem Dreifuß und baut daneben seine „Playstation“ auf, eine kleine Hütte mit Schreibtisch, Monitoren und PCs. „Über sie kann ich den Roboter steuern und live verfolgen, was er unter dem Eis sieht und misst.“ Neben ihm errichten Ozeanograf:innen, Meteorolog:innen, Datenwissenchaftler:innen ihre mobilen Basisstationen, starten Drohnen zu Erkundungsflügen, lassen Wetterballons in den Himmel steigen. Wege für Schneemobile werden markiert, kleine Straßen zum Transport von schwerem Gerät. Stück für Stück entsteht eine Stadt auf dem Eis, die die kilometerlange Scholle mit einem Netz von Messinstrumenten, Drohnen, Sensorik, Datenleitungen und Stromkabeln überzieht. Mit dem Ziel, das arktische System besser zu verstehen, um Vorhersagen machen zu können: Was kommt in der Klimakrise auf uns zu?

Globale Umwälzmaschine
Die Arktis erstreckt sich über ein Gebiet von etwa 20 Millionen Quadratkilometern zwischen Nordpol und 66°33′ nördlicher Breite – klar definierte Grenzen gibt es nicht. Ein Meer umgeben von Land, fifty-fifty. Eisflächen, Tundra, Nadelwälder und gerade mal 4 Millionen Einwohner:innen. Doch die Bedeutung der nördlichen Polkappe ist immens: Ihr Meereis kühlt den Planeten, lenkt Ozeanströmungen, bietet Lebensraum für unzählige Arten. Die Arktis ist Motor der globalen Umwälzmaschinerie für das Klima. Der Temperaturunterschied zu den mittleren Breiten treibt den Jetstream an, das große atmosphärische Transportband von Norden Richtung Äquator. Erwärmt sich die Arktis, nimmt der Temperaturunterschied ab, die Strömung wird schwächer. Die Folge: Hoch- und Tiefdruckgebiete halten sich länger an einer Stelle auf, der Wetterwechsel, typisch für unsere gemäßigten Breiten, weicht langen Extremen. Extrem kalt, warm, nass, trocken. Die Erwärmung der Arktis wiederum hängt wesentlich mit dem Rückgang des Meereises zusammen. Schuld ist der Albedo- oder Rückstreu-Effekt: Weniger
Eis heißt mehr dunkles Wasser. Dunkles Wasser nimmt mehr Energie – also Wärme – auf als helles Eis. Der Ozean erwärmt sich, das Meereis geht weiter zurück und so fort.
Im März 2025 gab es im Winter so wenig Meereis wie nie zuvor. Allerdings: Punktuelle Ergebnisse sagen wenig, je nach Bedingungen an den Messstationen erscheint der Rückgang mal größer, mal kleiner. Weil etwa Meereis durch Wind und Strömung unterschiedlich verteilt wird oder sich an der Küste auftürmt. „Entscheidend ist der langfristige Trend“, so Nicolaus. „Um etwa zwölf Prozent nimmt das Meereis derzeit pro Jahrzehnt im Sommer ab, im Winter sind es zwei bis drei Prozent. Dieser Trend setzt sich fort.“ Das Abschmelzen des Meereises hat nichts mit dem Anstieg der Meeresspiegel zu tun: „Das ist wie ein Wasserglas mit Eiswürfeln – schmelzen die Würfel, ist der Pegel genauso hoch wie vorher. Schmilzt dagegen das Festlandeis in Grönland, ist es, als würde man mit der Kanne neues Wasser in das Glas gießen – der Pegel steigt.“
Unterschätzter Schnee
Die Kisten für die nächste Sommerexpedition stehen bereit, alle Messgeräte sind verpackt. Nicolaus leitet die Expedition. In der Zentralen Arktis geht er der Frage nach: Wie schmelzen unterschiedlich alte Arten Eis? Und was verändert der Schnee? Mal ist er auf den Schollen zu kleinen Bergen zusammengeschoben, mal über die Fläche verstreut. Welche Auswirkung hat das auf Lichtreflexion, den Energieaustausch zwischen Meer und Luft, was bedeutet das für den Erhalt des Eises? „Neue Daten geben uns Hinweise, dass Schnee viel entscheidender ist, als vermutet“, so Nicolaus. „Wir haben das lange unterschätzt.“
Genau wie die Kerben, die die Kolonialgeschichte in der Region hinterlassen hat. Nach den Eroberern, die ihre Fahnen in das Eis der Arktis rammten, kamen die Wissenschaftler:innen mit ihren Forschungsfragen, Fördergeldern und vor allem einem Ziel im Kopf: ein Paper in einer renommierten Wissenschaftszeitschrift veröffentlichen, die Promotion voranbringen. „Die Fragen der Menschen vor Ort zählten lange wenig“, sagt Nicolaus. „Das ändert sich endlich.“ Forschungskooperationen sind entstanden, in denen westliche Wissenschaftler:innen und die lokale Bevölkerung zusammen an Themen arbeiten, die wichtig sind für die Menschen vor Ort. Was verändert die Klimakrise in unserer Bucht, wie können wir jagen, wenn die Fahrt übers tauende Meereis gefährlicher wird, was bedeutet die Meeresverschmutzung für unsere Ernährung?
Christa Marandino nimmt diesen Schmutz in den nächsten Monaten unter die Lupe. Die Biogeochemikerin am Meeresforschungszentrum Geomar in Kiel leitet eine Arbeitsgruppe von Iceberg, einem internationalen Forschungsprojekt, koordiniert von der finnischen Universität Oulu mit 16 Partnerorganisationen von Polen über Italien bis Grönland. Im Juli schwärmen die Teams aus, untersuchen Plastikabfälle und Schwermetalle, Nanopartikel, organische Schadstoffe und Ewigkeitschemikalien (PFAS) aus Industrie und Haushalten, die Meeresströmungen von Europa durch die ganze Arktis treiben. Was ist besonders schädlich für die Ökosysteme? Bremst das Mikroplastik die Entstehung der natürlichen Gase, die das Phytoplankton in den Ozeanen bildet und damit die Wolkenbildung anregt – ein wichtiger Baustein zur Abkühlung der Temperatur? Welche Auswirkungen haben Schiffsemi…
Anders als früher tragen Forscher:innen heute Hightech-Anzüge, schlafen in beheizten Kabinen, im Schiffsbauch gibt es sogar eine Sauna.