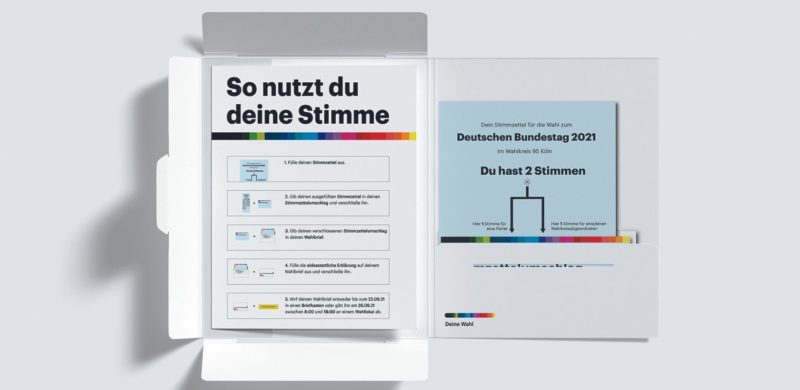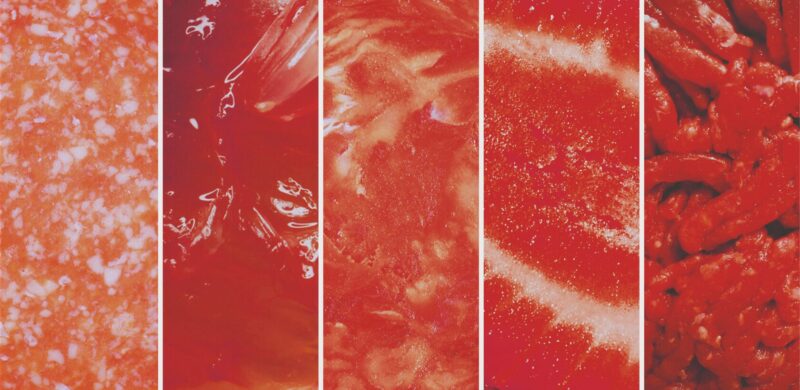Herr Bühler, das Bild einer Berliner Republik, geprägt von Ränkespielen einer Lobbykratie, ist verbreitet. Bedroht Lobbyismus die Demokratie?
Joachim Bühler: Nein, ohne professionelle Interessenvertretung funktioniert unsere liberale Demokratie nicht. Das Gemeinwohl entsteht erst aus dem Widerstreit von Interessen, die jedes Mal neu ausgehandelt werden müssen. Dafür müssen Entscheidungsträger:innen diese Interessen natürlich kennen. Lobbyismus gehört daher seit jeher zur Demokratie. Schon im frühen englischen und US-amerikanischen Parlamentarismus haben Vertreter:innen von Kirchen, Wirtschaft und Gesellschaft auf die Abgeordneten in der Wandelhalle, der Lobby, vor dem Parlament gewartet, um ihnen ihre Anliegen vorzutragen. Und dann musste die Politik entscheiden, welche Argumente sie überzeugend findet, welchen Interessen sie also welches Gewicht geben will.
Lobbyismus als Bedrohung, ja/nein?
Nein, sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Aufgabe der sechs TÜV Unternehmen in Deutschland ist es, Menschen und Umwelt vor negativen Folgen von Technik zu schützen.Wirtschaftsinteressen zum Beispiel …
Bühler: Nicht nur, Lobbyismus ist bunt wie unser Leben, heute gehören genauso soziale Einrichtungen, NGOs, Kirchen, Gewerkschaften, kleine zivilgesellschaftliche Initiativen dazu. Alle Organisationen, die professionell Bürger:innenanliegen vertreten. Egal, ob es um Kitaplätze oder eine Fabrikansiedlung geht.
Wofür trommeln Sie denn als TÜV?
Bühler: Für technische Sicherheit. Wir prüfen nicht nur Autos, sondern auch Kernkraftwerke, Lebensmittel oder Künstliche Intelligenz (KI). Wenn man sich im Parlament etwa über KI streitet, liefern wir Argumente für mehr KI-Sicherheit. Ein Abgeordneter ist ja meist kein KI-Experte. Um Entscheidungen treffen zu können, muss er wissen: Wie kann diese Technik überhaupt kontrolliert werden, was ist möglich, was ist sinnvoll?
Christina Deckwirth: Aber Herr Bühler, Sie zeichnen hier ein Idealbild von Interessenvertretung, das es so leider nicht gibt. Natürlich ist Lobbyismus grundsätzlich notwendig für eine Demokratie. Nur ist die Interessenvertretung eben nicht so bunt wie unser Leben. Zwar gibt es mittlerweile eine gewisse Vielfalt, doch die Ressourcen sind extrem unterschiedlich verteilt. Finanzstarke Akteur:innen werden sehr viel stärker wahrgenommen als andere. Das verzerrt politische Entscheidungen und gefährdet die Demokratie. Es geht um Macht.
Lobbyismus als Bedrohung, ja/nein?
Ja, sagt Christina Deckwirth, seit 2011 Referentin bei Lobbycontrol, einer NGO, die sich für eine bessere Kontrolle von Lobbyarbeit einsetzt. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Klima und Umwelt.Woran hakt es konkret?
Deckwirth: Konzerne und starke Wirtschaftsverbände haben mehr Geld und geben ein Vielfaches für Lobbyarbeit aus. Allein die Gasindustrie hat 2021 40 Millionen Euro in Lobbyarbeit gesteckt. Die drei größten Umweltverbände, die schwerpunktmäßig zu Gas arbeiten – BUND, Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe –, investierten zusammen nur 1,5 Millionen Euro, um ihrer Kritik Gehör zu verschaffen.
Spiegelt sich das Ungleichgewicht nur im Geld wider?
Deckwirth: Nein, auch in der Besetzung von Gremien oder einflussreichen Konferenzen. Beispiel Autogipfel der Bundesregierung. Dort wird auf hochrangiger Ebene verhandelt, welche Förderungen an die Autoindustrie fließen. Eigentlich versteht sich dieses Treffen als Mobilitätsgipfel. Doch eingeladen werden nur Autokonzerne, der Verband der Automobilindustrie (VDA), immerhin auch die IG Metall und die Betriebsräte. Aber warum fehlen alle Kritiker:innen? Umweltverbände, Wissenschaft, andere Verkehrsträger wie die Bahn?
Bühler: Ja, die Mittel sind sehr unterschiedlich verteilt, die Zahlen liegen auf dem Tisch. Aber: Ist es überraschend und ehrenrührig, dass Unternehmen mit wirtschaftsnahen Instrumenten für ihre Sache trommeln? Sie betreiben professionelles Marketing in eigener Sache. Die Regelungen des Staates betreffen sie ja auch besonders.
Christina Deckwirth, Referentin bei der NGO Lobbycontrol (li.), Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (re.).