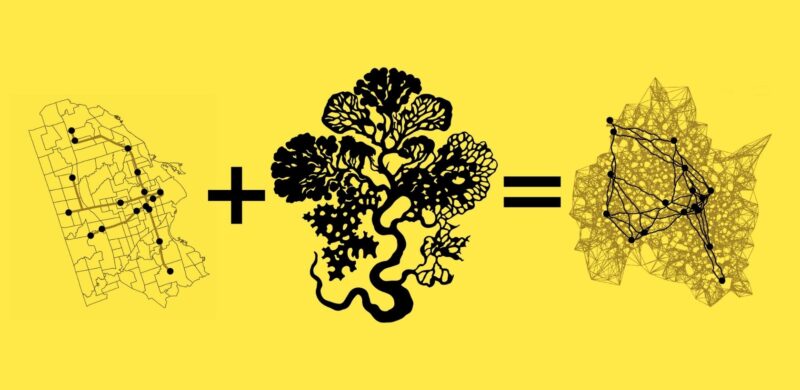Rechtsruck, Kriege, ökologische Krise. Viele sehen die Demokratien haltlos überfordert. Wie weiter?
Hedwig Richter: Unsere Demokratien müssen Meister in Sachen Krisenbewältigung werden. Die Klima– und die Biodiversitätskrise sind monströs. Nur wenn wir sie lösen, können wir unsere Demokratie überhaupt retten. Denn Demokratien sind angewiesen auf die geordnete Welt der Parlamente. Wenn in einer Kaskade von Notständen nur noch das Technische Hilfswerk und der Katastrophenschutz regieren, kann das kaum gut ausgehen für eine Demokratie.
Warum passiert dann so wenig?
Das habe ich mich mit meinem Co-Autor Bernd Ulrich auch gefragt, und wir sind auf ein Kernproblem der westlichen Gesellschaften gestoßen: Die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, überhaupt etwas bewirken zu können. Aber diese Haltung, dass man etwas ändern kann, ist zentral.
Die Menschen müssen wieder Selbstwirksamkeit erleben?
Genau, und das ökologische Projekt selbst kann der Motor sein. Denn hier kann jede:r etwas tun: umweltbewusst leben, sich mit anderen zusammenschließen, auf allen Ebenen Druck auf die Regierung machen, in der Kommunalpolitik, in der Parteiarbeit, in Bürger:innenräten, auf Demonstrationen, mit empörten Briefen an Abgeordnete. Letztlich geht es um Selbstermächtigung. Statt uns unaufgeklärt bequem im Weiter-so einzurichten, müssen wir uns befreien aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit; Verantwortung übernehmen für unser privates und politisches Leben. Wir nennen das die ökologische Revolution der Demokratie.
Das klingt nach dem alten Fingerzeig auf Konsument:innen: Reduziert mal euren ökologischen Fußabdruck. Inzwischen geht der Blick auf die Strukturen, die großen Hebel, die nur Wirtschaft und Politik umlegen können.
Natürlich zählt beides. Konzerne müssen Verantwortung übernehmen und viel stärker reguliert werden, die Politik muss den Menschen mit klaren Regeln die Last altruistischer Alltagsentscheidungen von den Schultern nehmen. Aber so gefangen wir auch in all den klimaschädlichen Strukturen sind – wir haben viel mehr Handlungsspielraum und Einfluss, als die meisten glauben. Besonders als Bürger:innen. Das sehen wir auch an der Politik der Ampel, die unter dem Vorbehalt regiert: Ach, wir können nichts machen, die Menschen wollen es ja nicht. Als müsse sie sich jede Klimamaßnahme per Plebiszit bestätigen lassen. Das zeigt, wie wichtig die Signale sind, die Bürger:innen der Politik senden.
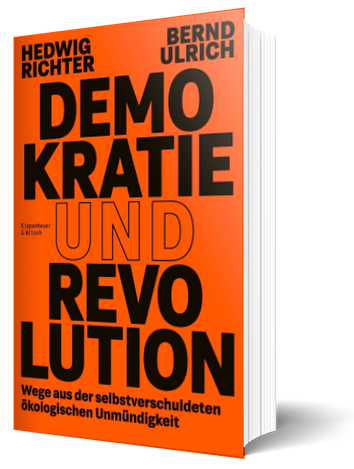
Sollte sich eine Regierung nicht um Mehrheiten bemühen?
Sicher, aber Demokratie ist nicht gleich Demoskopie. In einer repräsentativen Demokratie ist die Regierung keineswegs davon abhängig, ob die Bevölkerung tagesaktuell zustimmt oder nicht. Wir geben ja bewusst Verantwortung an sie ab. Die Geschichte der Demokratie ist voller Beispiele, bei denen Regierungen Entscheidungen gegen die aktuelle Stimmung trafen – und damit langfristig durchaus Mehrheiten gewinnen konnten.
Zum Beispiel?
Willy Brandt hat trotz großer Empörung seine Ostpolitik durchgesetzt, gerade mal 38 Prozent der Wähler:innen waren zunächst für seinen Kurs. Doch schon nach einiger Zeit hatte Brandt die Mehrheit mit seinen Taten überzeugt. Demokratie bedeutet eben nicht nur, ungebremst seinen Willen ausdrücken zu können, sie bedeutet noch nicht mal allein die Mehrheitsherrschaft. Sondern auf ganz vielen Ebenen bedeutet sie auch Einschränkung. Doch dieses Bewusstsein ist aus der Mode gekommen. Wir leben immer noch im Modus der vergangenen 70 Jahre, in denen jedes Problem mit Wachstum gelöst wurde. Jetzt müssen wir die Fließrichtung der Demokratie ändern. Das heißt: Ziel kann nicht mehr sein, dass es unseren Kindern mal besser geht, sondern dass unsere Kinder weiterhin ein gutes Leben haben. Dafür brauchen wir eine Tugend, die etwas altmodisch klingt: Disziplin. Wir müssen wieder lernen, Zumutungen hinnehmen und erkennen, dass sich diese lohnen. Denn sie retten unsere Zukunft. Statt…
Hedwig Richter, Demokratiehistorikerin an der Hochschule der Bundeswehr in München
Weiterlesen

Gemeinsam statt gegeneinander
Wie israelisch-palästinensische Initiativen Friedensarbeit leisten
Seit dem Massaker der Hamas und dem Krieg in Gaza ist ein Dialog zwischen jüdischen Israelis…
Bundestagsabgeordnete Schahina Gambir
Einfach mal das Land verändern
Schahina Gambir gehört zu den Neulingen im Bundestag. Vor 28 Jahren floh sie mit ihrer Familie…
Schwerpunkt: Glokalisierung
C&A näht Hosen wieder in Deutschland
C&A erprobt in Mönchengladbach die Deglobalisierung: Jeans nähen in Deutschland. Wie funktioniert das und welche Vorteile…