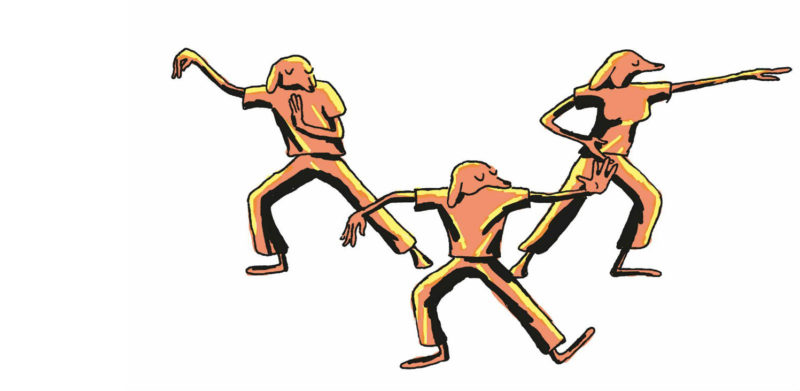Slowenien: Sondermüll im Wäschesack
Jede Woche spült ein Durchschnittshaushalt beim Waschen etwa eine Plastiktüte voller Mikroplastik ins Abwasser. Die slowenische Juristin Mojca Zupan hat mit PlanetCare einen anschraubbaren Filter für Waschmaschinen entwickelt, der 90 Prozent des Mikroplastiks abfängt.
Inwiefern ist der Filter von PlanetCare kreislauffähig?
Mojca Zupan: Wenn Kund:innen unsere Filter nach 20 Waschgängen entsorgen würden, landeten die Fasern auf der Mülldeponie und gelangten so in die Natur. Also bekommen sie ein vorfrankiertes Label, um die Kartuschen kostenlos an uns zurückschicken zu können. Wir reinigen und verschicken sie wieder. Nur das Filtermedium recyceln wir. Es macht fünf Prozent des Produkts aus. Daraus wollen wir Dämmmatten herstellen, zum Beispiel zur Gebäudeisolierung. Auch die Schalldämmung in Waschmaschinen ist eine Option. Aktuell sind das aber nur Pläne, denn fürs Recycling werden 1.000 Kilogramm Fasern benötigt; nach 20 Waschgängen sammeln sich gerade mal 20 Gramm im Filtermedium. Also lagern wir sie.
Anstatt Konsument:innen zur Verantwortung zu ziehen, könnten die Modefirmen nicht auf Plastik verzichten?
Klar, am besten bekämpft man Verschmutzung an der Quelle. Allerdings wollen sich acht Milliarden Menschen kleiden, 60 Prozent ihrer Garderobe besteht aus Polyester. Es ist ein demokratisches Material: erschwinglich und vielseitig. Wir werden nie in der Lage sein, alle Kunststoffe durch Naturfasern zu ersetzen. Firmen müssen die synthetische Textilien so herstellen, dass sie beim Waschen kaum haaren. Dann sollten Konsument:innen wissen, wie sie den Faserverlust beim Waschen verringern können. Und letztlich müssen Hersteller zur Filter-Integrierung verpflichtet werden.
Was ist mit den Kläranlagen?
Das Abwasser eines Haushalts wird in die Kläranlagen geleitet, die in erster Linie entwickelt wurden, um das Wasser zu desinfizieren und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Bei der Reinigung des Wassers werden auch eine Menge Mikrofasern aufgefangen. Kläranlagen gewinnen letztlich Schlamm aus organischen Stoffen. Aber viele Länder, darunter Deutschland, verwenden den Klärschlamm als Düngemittel – wodurch die darin enthaltenen Mikrofasern doch in die Umwelt gelangen. Deshalb müssen wir die Mikrofasern filtern, bevor das Wasser in die Kläranlagen gelangt.
Warum sind Mikroplastik-Filter noch kein Werksstandard bei Waschmaschinen?
Die meisten Menschen dachten lange, die Verschmutzung durch Mikrofasern sei ein Nischenproblem. Aber 35 Prozent der Meeresverschmutzung kommt durch Kleidung! Die Waschmaschinenhersteller müssten ihre gesamte Produktion anpassen, wenn sie einen Filter einbauen wollen. Sie sind nicht bereit, den Sprung zu wagen, es sei denn, es gibt Gesetze. Das Gleiche gilt für Autoreifen-Hersteller. Der Plastik-Abrieb von Reifen ist für die restlichen 65 Prozent verantwortlich.
Frankreich hat reagiert: Ab 2025 sind Mikroplastikfilter Pflicht.
Wir wurden vom Kabinett in die Gruppe eingeladen, die diese Gesetzgebung vorbereitet hat, weil wir zeigen konnten: Es ist machbar. Andernfalls hätten die Waschmaschinenhersteller das Gesetz blockiert – „technisch unmöglich, zu teuer“ und so weiter. Auch ein Senator aus Connecticut und die Stadtverwaltung von San Francisco haben sich an uns gewandt, weil wir die einzige einsatzbereite Lösung haben. Wir üben Druck auf die EU aus und sitzen in einer niederländischen Regierungsgruppe.
Erst Firmenanwältin, jetzt Sozialunternehmerin. Ist Slowenien ein guter Ort zum Gründen?
Es gibt definitiv viele Talente in Slowenien – ich sitze mit 14 passionierten Kolleg:innen in Ljubljana. Das slowenische Start-up-Ökosystem hat schon einige Erfolgsgeschichten geschrieben, etwa Animacel (Stammzellenbehandlung für Tiere), Quadrofoil (E-Wasserfahrzeuge) und Visionect (E-Papier). Slowen:innen haben ein große…
Die Freiheitsbrücke in Budapest bei Sonnenaufgang. Osteuropäische Städte wie diese haben sich zu den größten Tech-Standorten Europas entwickelt.
Weiterlesen
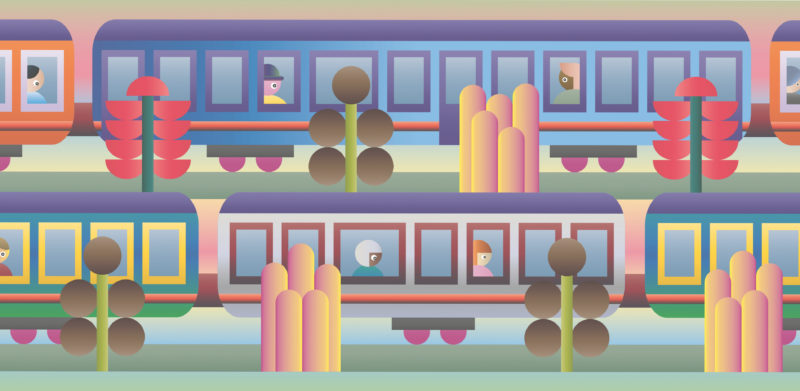
Schwerpunkt: Nachhaltiger Städtebau
Das hat der kostenlose Nahverkehr in Estland gebracht
Seit zehn Jahren fahren Bürger:innen der estnischen Hauptstadt Tallinn umsonst Bus, Bahn und Tram. Was hat…
Festivals als Klimaretter
Feiert die Energiewende!
Jacob Bilabel hat vor mehr als zehn Jahren die Green Music Initiative gegründet. Sein klares Ziel:…
Der Bär im Fadenkreuz
Möglichst groß, möglichst schwer. Bärenjagd zum Sport boomt in Rumänien. Aber es gibt Ideen, was sich…